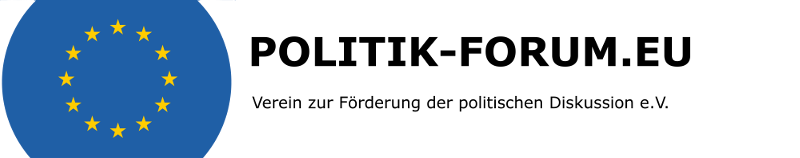ich habe mir erlaubt, das Wasserstoff-Thema aus dem EEG-Strang auszukoppeln.
Wasserstoff ist kein reines EEG-Thema und beim EEG dreht es sich bislang fast ausschließlich NICHT um Wasserstoff-Anwendungen.
Das EEG ist zwischen 2000 und 2020 eher ein Wasserstoffkiller.
Warum ist das so?
Man bekam bisher für EE-Strom durch die EEG-basierten Förderinstrumente viel zu viel Geld, als dass man ihn hinreichend billig an die Industrie abgegeben hätte.
In der Verfahrenstechnik spielt Wasserstoff aus Elektrolyse bisher keine relevante Rolle. Dafür braucht man billigen Strom in Menge. Stattdessen holt die Industrie bisher Wasserstoff vor allem aus Erdgas durch Dampfreformation. (Raffinerietechnik, Methanolsynthese, Ammoniaksynthese)
Würde man der Industrie den grünen Wasserstoff preislich schmackhaft machen, entstünde eine Abnahme von bis zu 20 Gigawatt.
Wasserstoff für Industrieanwendungen wird direkt vor Ort gewonnen, Transporte werden möglichst vermieden.
Das muss das Netz erstmal abkönnen. Bisher diskutiert ihr oft Wasserstoffproduktion zur Vermeidung von Netzspitzen und Wasserstoffanwendung (Brennstoffzelle) oder Methanisierung (Erdgas) folgt dann aus der Verfügbarkeit. Das erscheint mir verkehrt herum.
Wasserstoff und Brennstoffzelle sind seit den 80ern immer wieder "morgen" marktreif, die Zukunftstechnik. Man kann von einem Fußballer sprechen, der mit Mitte 30 immer noch als Hoffnungsträger und ewiges Talent aufgestellt wird, aber bisher wenige Tore geschossen hat. Zwar gibt es Licht am Ende des Tunnels, wasserstoffbasierte Regionalzüge gibt es zu kaufen (aber unwirtschaftlich teuer), wasserstoffbasierte Schiffe gibt es als Experiment. Ein wasserstoffbasiertes Kleinflugzeug gibt es auch. Jedoch braucht es meiner Meinung nach mindestens ein "Mobilitäts-EEG" für 2-3 Jahrzehnte, bis diese Technik am Markt bestehen kann und die Verkehrsnetze auch entsprechende Lade- und Wartungspunkte beinhaltet.
Über Erdgas- und Wasserstoffautos möchte ich an dieser Stelle mal nicht nachdenken. Ich sehe die naheliegendsten Anwendungen für grünen Wasserstoff derzeit eher stationär - wenn es denn bezahlbar gemacht wird. Das wird nicht "von selbst" passieren.
Nun ein Blick auf deinen Beitrag:
Ja, da gehen die Probleme los.H2O hat geschrieben:(04 Feb 2019, 01:11)
Dieses Prinzip stimmt natürlich unverändert. Verfahrenstechnisch wird aber die Ausbeute, der technische Wirkungsgrad von eingesetzter Energie und gespeicherter Energie im freigesetzten Wasserstoff als Brennstoff durch die Wassertemperatur, Druck und beigemischte Katalysatoren stark erhöht auf unglaubliche 97%. ("alkalische Wasserstoffsynthese")
http://www.fvee.de/fileadmin/publikatio ... 004_03.pdf
In einer zweiten Synthesestufe wird dem Wasserstoff Kohlendioxyd aus Industrieprozessen oder aus der Biogasanlage zugeführt, um daraus synthetisches Methan zu erzeugen. Auch das wird Verfahrenstechnisch unterstützt durch Wärme und Katalysatoren, so daß hier insgesamt von Strom hinein bis Methan heraus ein energetischer Wirkungsgrad von 75 % erzielt wird. Das ist natürlich ein gewaltiger Fortschritt gegenüber den früher üblichen 30 %.
- Sicherstellung der CO2-Quelle bei unregelmäßigem Verbrauch, Vermeidung von Unter- und Überversorgung -> Dimensionierung des Lagers.
- Nutzung ist zwar saisonal planbar, aber im konkreten Verlauf unregelmäßig
- Die Bemühungen um Dynamisierung von Netz und konventionellen Kraftwerken verringern eher noch die Zeiten, in denen das Verfahren laufen wird. Dagegen steht der Zubau an EE
- Die Apparate sind relativ teuer, schreiben sich kontinuierlich ab, haben aber deutlich weniger Betriebsstunden als die EE-Anlage selbst. Der Rückgang des Anlagenpreises wird bisher eher zurückhaltend geschätzt (50% über 25 Jahre).
- Für Betriebsstoffe und Wartungsaufwände gibt es noch keine öffentlich bekannte Faustformel.
Man wird in der Praxis einen Park, der so eine Anlage bedient, wohl eher nur bis zu einem definierten Maximum ins Netz einspeisen lassen, das Anfrage unter/überschritten wird (teurer Regelstrom) sodass die Anlage auf einem definierten Niveau Betriebsstunden sammelt. Damit widerspricht man aber dem bisherigen unbedingten Einspeisevorrang, nach dem EE-Strom nur dann nicht ans Netz geht, wenn es technisch unvermeidbar ist. Hier den richtigen Kompromiss aus Wirtschaftlichkeit und CO2-Vermeidung zu finden, dürfte spannend werden.
Anhang: Eine inzwischen etwas betagte Studie zur Nutzung von EE-Gasen hat 2013 der BEE vorgelegt. http://www.lbst.de/download/2014/201312 ... EEGase.pdf betrachtet vergleichend Biogasanlagen und Windparks.