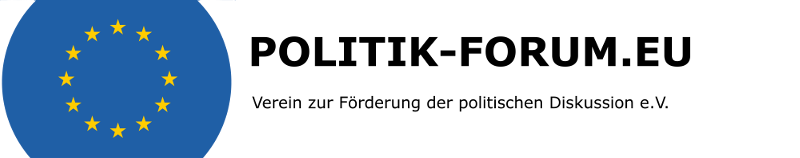17.-18.3.14
Befristung: Geteiltes Echo bei Experten Ausschuss für Arbeit und Soziales
Die Forderung der Fraktion Die Linke nach einer Abschaffung der sachgrundlosen Befristung stößt bei Experten auf ein geteiltes Echo. In der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am Montagnachmittag zu einem entsprechenden Gesetzentwurf (18/7) der Linken votierten vor allem Arbeitgeberverbände aber auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gegen die im Entwurf enthaltenen Vorschläge.
Darin hatten die Abgeordneten argumentiert, dass im Jahr 2012 bereits 44 Prozent aller Neueinstellungen befristet erfolgten. Da davon besonders junge Menschen betroffen seien, würde ihnen die Chance genommen, ihr Leben auf der Grundlage eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit einer gewissen Sicherheit planen zu können. „Auch aus arbeitsrechtlicher Perspektive sind befristete Arbeitsverhältnisse hochproblematisch, da sie den Kündigungsschutz aushöhlen“, begründen die Abgeordneten ihre Initiative. Sie verlangen deshalb, im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit der Befristung ohne Sachgrund zu streichen. „Eine Befristung darf nur zulässig sein, wenn es für sie einen sachlichen Grund gibt“, heißt es in dem Entwurf.
Roland Wolf von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände argumentierte stattdessen, dass sachgrundlose Befristungen kein Massenphänomen seien. Für viele Arbeitnehmer seien sie aber unverzichtbar für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, und für die Wirtschaft seien sie wichtig, um auf schwankende Auftragslagen zu reagieren.
Christian Hohendanner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verwies zwar auf den starken Anstieg befristeter Arbeitsverhältnisse. So habe sich die Zahl befristeter Arbeitsverträge von 2001 bis 2011 von 1,7 auf 2,7 Millionen und die Zahl sachgrundloser Befristungen von 2001 bis 2013 von 550.000 auf 1,3 Millionen erhöht. Er würdigte jedoch die „Brückenfunktion“ dieser Beschäftigung: „Je höher der Anteil sachgrundloser Befristungen an den in den Betrieben eingesetzten befristeten Arbeitsverhältnissen, umso höher fällt die Anzahl der innerbetrieblichen Übernahmen in unbefristete Beschäftigung aus“, sagte Hohendanner.
Barbara Pommer vom Verband der Familienunternehmer e. V. betonte, sachgrundlose Befristungen abzuschaffen, würde bedeuten, „auf dem Ast zu sägen, auf dem wir sitzen“. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten würden Unternehmen verstärkt auf dieses Instrument zurückgreifen, um trotzdem Beschäftigung zu schaffen. Außerdem seien die Übernahmequoten aus dieser Beschäftigung relativ hoch.
Unterstützung erfuhr der Gesetzentwurf dagegen von Gewerkschaftsseite. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) verwies Helga Nielebock auf die „äußerst negativen Wirkungen“ sachgrundloser Befristungen: „Wer ohne Zukunftsperspektive einen Arbeitsvertrag eingeht, von dem er nicht weiß, ob er länger als zwei Jahre besteht, schränkt sich im Konsum ein und nimmt Arbeitsbedingungen hin, die mit gesetzlichen oder tariflichen Vorschriften nicht zu vereinbaren sind.“ Zudem seien die beschäftigungspolitischen Wirkungen, die man sich mit diesem Instrument versprochen habe, nicht eingetroffen, mahnte sie.
Reingard Zimmer, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität Hamburg, forderte ebenfalls die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Erstens könne von einem Ausnahmecharakter hier keine Rede sein. Zweitens hebele dieses Instrument den Sonderkündigungsschutz aus, betonte Zimmer. So ende der Arbeitsvertrag mit Ablauf der vereinbarten Zeit auch bei schwangeren Frauen, die mit einem unbefristeten Vertrag bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung dem absoluten Kündigungsschutz unterliegen. Auch befristet Beschäftigte, die in den Betriebsrat gewählt werden, genössen diesen Sonderkündigungsschutz nicht, so Zimmer.
Nadine Zeibig, Arbeitsrechtlerin und Anwältin aus Düsseldorf, verwies auf Forschungsergebnisse, die belegen, dass sachgrundlose Befristungen nicht zu zusätzlicher Beschäftigung geführt haben, sondern im Gegenteil unbefristete Beschäftigungsverhältnisse ersetzen. Sie würden außerdem weder benachteiligte Beschäftigtengruppen spürbar in den ersten Arbeitsmarkt integrieren noch eine Brücke in unbefristete Arbeitsverhältnisse darstellen. Deshalb sei die Abschaffung der sachgrundloses Befristung absolut gerechtfertigt, schlussfolgerte Zeibig.
Sachgrundlose Befristung bleibt Ausschuss für Arbeit und Soziales
Auch künftig ist es Arbeitgebern möglich, Beschäftigte ohne Begründung befristet einzustellen. Die Fraktion Die Linke konnte sich mit ihrem Gesetzentwurf (18/7) zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung nicht durchsetzen. Am Mittwochvormittag lehnte der Ausschuss für Arbeit und Soziales die Vorlage mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD ab. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich.
Der Gesetzentwurf der Linken zielt darauf ab, im Teilzeit- und Befristungsgesetz die Möglichkeit der Befristung ohne Sachgrund zu streichen. „Eine Befristung darf nur zulässig sein, wenn es für sie einen sachlichen Grund gibt“, heißt es in dem Entwurf. Die Abgeordneten begründen ihren Vorstoß damit, dass im Jahr 2012 bereits 44 Prozent aller Neueinstellungen befristet erfolgten. Da davon besonders junge Menschen betroffen seien, würde ihnen die Chance genommen, ihr Leben auf der Grundlage eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit einer gewissen Sicherheit planen zu können. „Auch aus arbeitsrechtlicher Perspektive sind befristete Arbeitsverhältnisse hochproblematisch, da sie den Kündigungsschutz aushöhlen“, schreiben die Abgeordneten.
„Wir stehen zu unserer Forderung, denn es kann doch nicht sein, dass Personalchefs in sechs Monaten nicht in der Lage sind, Mitarbeiter zu beurteilen und die sachgrundlose Befristung als verlängerte Probezeit brauchen“, verteidigte Die Linke ihre Position. Sie wies darauf hin, dass der Anteil der sachgrundlosen Befristungen an allen Befristungen allein von 2012 bis 2013 um vier Prozent gestiegen sei.
Die Grünen sprachen sich zwar ebenfalls für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung aus. Es gebe genügend andere Möglichkeiten, Beschäftigte flexibel einzustellen, so das Argument der Fraktion. Ihre Enthaltung begründete sie damit, dass sie bei Unternehmensgründungen die sachgrundlose Befristung erhalten wolle, und dies in der Vorlage der Linken nicht entsprechend berücksichtigt werde.
Die SPD-Fraktion betonte, sie habe sich in ihrem Wahlprogramm ebenfalls für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ausgesprochen. Aus Gründen der Koalitionsräson mit der Union werde die Fraktion nun jedoch gegen den Entwurf stimmen. Angesichts aktueller Zahlen über den hohen Anteil derjenigen Beschäftigten, die aus so einem Arbeitsverhältnis übernommen werden, sei diese Position auch zu rechtfertigen, hieß es aus der Fraktion.
Die CDU/CSU hob noch einmal hervor, dass es gute Gründe gebe, den Entwurf der Linken abzulehnen. „Wir brauchen einen möglichst flexiblen Arbeitsmarkt.“ Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass sachgrundlose Befristungen grundsätzlich nur zwei Jahre möglich sind. Würde man diese ganz abschaffen, dann würden sich gerade kleine Betriebe gar nicht mehr mit dieser Thematik beschäftigen, da der Bürokratieaufwand der anderen Befristungsformen zu hoch sei.
NSA war Thema auf Innenminister-Treffen Inneres/Antwort
Die Innenminister der sechs bevölkerungsreichsten EU-Staaten – Deutschland, Frankreich, England, Italien, Spanien und Polen – haben sich bei ihrem Treffen am 5. und 6. Februar dieses Jahres in Krakau laut Bundesregierung unter anderem mit der „Überwachung von EU-Bürgern durch die US-Geheimdienste“ befasst. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (
18/722) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/541) hervorgeht, befassten sich die Teilnehmer bereits am ersten Sitzungstag mit diesem Thema. Am zweiten Sitzungstag, an dem den Angaben zufolge auch Vertreter der USA teilgenommen haben, habe man sich mit dem Thema „Terrorismus – Aktuelle Herausforderungen“ und der Überwachung von Bürgern sowie dem Schutz der Privatsphäre befasst.
Bei den transatlantischen Themen wurden laut Antwort „Maßnahmen der U.S. National Security Agency (NSA) zur Analyse von Telekommunikations- und Internetdaten behandelt“. Die US-Seite habe zu PRISM/NSA berichtet, man „sei zu dem Schluss gekommen, dass die weitere Sammlung zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit zwar notwendig sei, es aber eines besseren Datenschutzes und besserer Rechtschutzmöglichkeiten bedürfe“. Ziel sei mehr Transparenz, die Beschränkung der Datensammlung und Änderungen bei der Rechtsaufsicht. Man sei „bemüht, Vertrauen wiederherzustellen“.
Weiter berichtete die US-Seite der Vorlage zufolge, dass die Sammlung von Massendaten auch in den USA zu Diskussionen geführt habe. Die von US-Präsident Barack Obama angekündigten Maßnahmen würden in den nächsten Monaten umgesetzt. „Man habe auf US-Seite verstanden, dass die Nachrichtendienste nicht alles tun sollten, wozu sie technisch in der Lage seien“, heißt es in der Antwort weiter.
Zum Seitenanfang
Ortsumgehungen kosten 21,4 Millionen Euro -Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort
Thüringen hat auf Grundlage der aktuellen Planungen für die Ortsumgehungen von Großebersdorf, Frießnitz und Burkersdorf im Zuge der B 175 Kosten in Höhe von 21,4 Millionen Euro ermittelt. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (
18/758) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/660). Sie weist darauf hin, dass durch Baupreissteigerungen sowie die Einführung und Fortschreibung von Vorschriften gemäß dem aktuellen Stand der Technik im Laufe der Zeit höhere Baukosten zu ermitteln sind.
Noch 910 Millionen Euro notwendig - Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort
Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort (
18/778) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/652) zur Umsetzung des Bedarfsplans Schiene im Freistaat Sachsen vor allem auf den
Verkehrsinvestitionsbericht (
18/580). Für die darin als offen bezeichneten Abschnitte seien nach Angaben der Deutschen Bahn AG Investitionen in Höhe von rund 910 Millionen Euro erforderlich. Die hierfür jeweils notwendigen Finanzierungsvereinbarungen würden nach Vorlage der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschlossen.
Atomkraftwerk Gundremmingen - Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Antwort
Die Bewertung der Erdbebenfestigkeit der Nachkühlketten des Atomkraftwerks (AKW) Gundremmingen ist unabhängig vom „Zusätzlichen Nachwärmeabfuhr- und Einspeisesystem“ (ZUNA) erfolgt. Das teilt die Bundesregierung in einer Antwort (
18/741) auf eine Kleine Anfrage (18/644) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit. Nach Aussage der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), sei das ZUNA errichtet worden, um einen durch denselben Fehler verursachten Ausfall der Not- und Nachkühlketten zu beherrschen.
Die Grünen-Fraktion hatte in ihrer Anfrage unter anderem wissen wollen, ob das AKW die Sicherheitsanforderungen an Atomkraftwerke erfülle und inwiefern und in welchem Umfang das ZUNA bislang zur Bewertung der Erdbebenfestigkeit der Nachkühlketten sowie zur Beherrschung von Störfällen herangezogen worden sei. Nach Ansicht der Fraktion habe die Bearbeitung eines bis Dezember 2013 anhängigen Antrags auf Leistungserhöhung für das AKW Gundremmingen Fragen zur sicherheitstechnischen Auslegung des Atomkraftwerks ergeben.
Die Bundesregierung schreibt dazu, das bisher keine abschließende Bewertung zur Erdbebenauslegung des Kraftwerks Gundremmingen seitens des StMUV vorliege. Es werde diese Bewertung aber noch im März 2014 vorlegen.
Reform des Emissionshandels
Die Bundesregierung spricht sich für eine Stärkung des Emissionshandels als das zentrale europäische Klimaschutzinstrument aus, um einen angemessenen Anreiz für Investitionen in Maßnahmen für nachhaltige Emissionsreduktionen zu erhalten. Außerdem begrüßt sie grundsätzlich den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung einer Marktstabilitätsreserve. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (
18/755) auf eine Kleine Anfrage (18/651) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Derzeit liege ein Vorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung einer Marktstabilitätsreserve ab dem Jahr 2021 vor. Ob und in welcher Form dieser Vorschlag von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament angenommen werde, sei noch nicht bekannt, schreibt die Bundesregierung. Sie betont, sie befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung zu ihrer konkreten Positionierung. Die Abstimmungen zum zweiten Regierungsentwurf zum Wirtschaftsplan 2014 des Energie- und Klimafonds (EKF) sowie zu den Eckwerten für den Wirtschaftsplan 2015 seien noch nicht abgeschlossen.
Weiter schreibt die Bundesregierung, sie halte an ihrem Ziel fest, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Sie betrachte dabei den EU-Emissionshandel als das zentrale klimapolitische Instrument für die Sektoren Energiewirtschaft und energieintensive Industrie. Daher unterstütze sie eine nachhaltige Reform des EU-Emissionshandels, durch die unter anderem die Verwendung von Braun- und Steinkohle zur Stromerzeugung gegenüber der Verstromung von Erdgas verteuert würde.
Zur Stärkung des Emissionshandels sei auf europäischer Ebene bereits die vorübergehende Herausnahme von 900 Millionen Zertifikaten aus den Auktionsmengen für die Jahre 2014 bis 2016 (so genanntes Backloading) beschlossen worden, betont die Bundesregierung. Darüber hinaus begrüße sie die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Einführung einer Marktstabilitätsreserve.
Diese scheine grundsätzlich geeignet, den CO2-Preis zu stabilisieren und einen angemessenen Anreiz für Investitionen in Maßnahmen für langfristige Emissionsreduktionen zu erhalten.
Gleichberechtigte Teilhabe bleibt Ziel
Die Bundesregierung bewertet die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland insgesamt positiv. Das geht aus ihrer Antwort (
18/734) auf eine Kleine Anfrage (18/525) der Fraktion Die Linke hervor. So sei die Erwerbstätigkeit von Frauen in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gestiegen und lag im Jahr 2012 mit einer Quote von 71,5 Prozent so hoch wie noch nie. Im europäischen Vergleich habe Deutschland zu den skandinavischen Ländern aufgeschlossen und nehme mittlerweile den 5. Rang hinter Schweden, Finnland, Dänemark und den Niederlanden ein, schreibt die Regierung. Frauen stellten nicht nur 46 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland, sie hätten in den vergangenen zehn Jahren auch überproportional zum Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beigetragen.
„Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben ist allerdings noch nicht realisiert“, heißt es in der Antwort. Dies zeige sich an verschiedenen Punkten: an dem hohen Anteil von Teilzeitarbeit bei Frauen, an der geringen Zahl von Frauen in Führungspositionen sowie dem gesamtwirtschaftlichen Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. „Insofern ist die Tatsache, dass Frauen in der Bildung mit den Männern zwischenzeitlich etwa gleichgezogen haben, auf dem Arbeitsmarkt noch nicht entsprechend umgesetzt“, führt die Regierung aus. Als wichtigste politische Handlungsfelder in dieser Legislaturperiode bezeichnet sie deshalb Maßnahmen zur Verringerung der Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern und zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Nicht zuletzt gelte es, stärkere Anreize für vollzeitnahe eschäftigungsformen zu setzen. „Alle Frauen und Männer sollten in dem zeitlichen Umfang arbeiten, der ihren Wünschen entspricht“, heißt es in dem Schreiben weiter.
Hohes Risiko durch fehlenden Abschluss
Für eine qualifizierte Bewertung der Initiative „AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“ ist es aus Sicht der Bundesregierung noch zu früh. Das schreibt sie in ihrer Antwort (
18/754) auf eine Kleine Anfrage (18/648) der Fraktion Die Linke. Mit dieser Initiative wollen das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) verstärkt junge Menschen von 25 bis 35 Jahren dafür gewinnen, einen Berufsabschluss nachzuholen. Das Programm startete im Februar 2013.
Ein fehlender Berufsabschluss sei nach wie vor mit einem überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeitsrisiko verbunden. So habe die Arbeitslosenquote der betroffenen Personen im Jahr 2012 bei 19 Prozent gelegen. Bei Fachkräften mit beruflicher Ausbildung (ohne Hochschulabsolventen) habe sie dagegen nur 5 Prozent betragen, schreibt die Regierung. „Der qualifikationsspezifische Strukturwandel wird dazu führen, dass die Zahl der Erwerbstätigen ohne Berufsausbildung an der Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2030 zurückgeht. Die Anstrengungen müssen sich daher verstärkt auf die unteren Qualifikationsbereiche richten“, heißt es in der Antwort weiter.
Illegale Holzimporte nach Deutschland
Im Jahr 2009 wurden nach Berechnungen des Johann Heinrich von Thünen-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, 2,4 bis 5,2 Millionen Kubikmeter Holz und Produkte auf Basis Holz aus illegalem Einschlag nach Deutschland importiert. Das geht aus einer Antwort (
18/756) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (18/655) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor. Das entspreche 2 bis 5 Prozent der gesamten Holzeinfuhren. Weiter heißt es, dass die Regierung davon ausgeht, dass die Einfuhr illegal geschlagenen Holzes seitdem gesunken ist. Das vorliegende Datenmaterial lasse keine Aussage darüber zu, ob das Holzhandels-Sicherungsgesetz (HolzSiG) zur Verminderung des illegalen Holzhandels beitrage. Die Regierung stelle aber fest, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes im März 2013 die Importeure von Holzerzeugnissen höher sensibilisiert seien.
Nationales Waffenregister
In der „Zentralen Komponente“ des Nationalen Waffenregisters sind mit Stand Januar 2014 laut Bundesregierung knapp 1,47 Millionen natürliche Personen und gut 5,45 Millionen Waffen gespeichert gewesen. Wie die Bundesregierung dazu in ihrer Antwort (
18/723) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (18/539) erläutert, zählen zu den gespeicherten Personen nicht nur derzeitige Besitzer von Schusswaffen, sondern auch Verstorbene und ehemalige Waffenbesitzer, deren Daten noch vorzuhalten sind, sowie Personen, denen ein rechtskräftiges Waffenbesitzverbot erteilt wurde. Die Zahl der Schusswaffen beinhaltet den Angaben zufolge neben den derzeit in Privatbesitz befindlichen Waffen unter anderem auch vernichtete, deaktivierte und exportierte Waffen.
Sozialabkommen mit Uruguay angenommen
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am Mittwochvormittag einstimmig einen Gesetzentwurf (
18/272) der Bundesregierung angenommen, der ein Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen Deutschland und der Republik Östlich des Uruguay umsetzt. Darin geht es unter anderem um Regelungen, die eine Doppelversicherung von Arbeitnehmern verhindern sollen, die von ihren Betrieben in das jeweils andere Land entsendet werden. Die Arbeitnehmer sollen allein den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates, in der Regel des Heimatstaates, unterliegen, heißt es in dem Entwurf. Darüber hinaus sehen die Regelungen die uneingeschränkte Zahlung von Renten in den anderen Staat vor. Die Voraussetzungen dafür könnten durch die Zusammenrechnung der in beiden Staaten zurückgelegten Versicherungszeiten erfüllt werden, schreibt die Regierung.
Politisch motivierte Tötungsdelikte
Die Polizei hat in den Jahren 2001 bis einschließlich 2012 im Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität zwei politisch rechts sowie zwei politisch links motivierte Tötungsdelikte erfasst, die sich gegen den „gesellschaftlichen Status“ der Tatopfer richteten. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (
18/740) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/639) hervor. Danach entfielen die beiden politisch rechts motivierten Tötungsdelikte auf die Jahre 2002 und 2008, während sich die zwei politisch links motivierten Tötungsdelikte im Jahr 2011 ereigneten.
Erste Erfolge bei Fachkräftesicherung
Die Bundesregierung sieht die Fachkräftesicherung in Deutschland auf einem guten Weg. In ihrem Fortschrittsbericht 2013 zu ihrem Fachkräftekonzept, der nun als Unterrichtung (
18/796) vorliegt, schreibt sie, auf dem Weg zur Fachkräftesicherung zeigten sich „respektable Fortschritte“. So nehme die Erwerbsbeteiligung zu und der Anteil von Frauen und Älteren im Arbeitsmarkt steige. Die Ziele Deutschlands im Rahmen der EU-2020-Strategie seien bei Älteren bereits erreicht worden. In den vergangenen Jahren habe sich deren Erwerbsbeteiligung kontinuierlich erhöht und erreichte 2012 erstmals eine Quote von 60 Prozent. „Dennoch sinkt die Teilhabe Älterer am Arbeitsmarkt weiter deutlich mit dem Alter und Ältere bleiben deutlich länger arbeitslos als Jüngere“, führt die Regierung aus. Bei Frauen nähere sich der aktuelle Anteil dem Zielwert an. Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Regierung allerdings bei den nach wie vor hohen Teilzeitquoten und niedrigen durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten von Frauen.
Handlungsbedarf sieht die Regierung außerdem beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit: „Diese reduzierte sich zwar in den vergangenen Jahren deutlich, bewegt sich aber trotz des insgesamt positiven Arbeitsmarktes mit etwa einer Million Langzeitarbeitslosen auf zu hohem Niveau. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen in diesem Bereich“. Gleichzeitig müsse es auch darum gehen, Weiterbildung zu fördern und die Zahl der Schul- und Studienabbrüche weiter zu reduzieren, heißt es in der Unterrichtung.
Warum töten wir Menschen die Menschen töten, um den Menschen zu zeigen, dass Töten falsch ist?
Amnesty International.