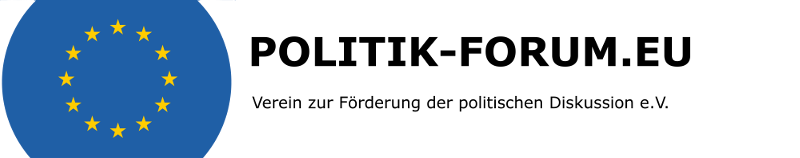Es gibt schon den einen oder anderen Thread zum Thema Kirchen, aber auch zu Gewerkschaften. Ich will einmal einen eigenen eröffnen, mit der grundsätzlichen Frage, inwieweit beide Organisationen in der jetzigen Form dauerhaft überlebensfähig sind.
Meines Erachtens haben die beiden Amtskirchen ein ähnliches Problem wie die Gewerkschaften. Sie schaffen die Transformation von der faktischen Zwangsmitgliedschaft zur freiwilligen nicht.
Für die anderen christlichen Kirchen gilt das nicht in demselben Maß, wobei hier die Mitgliedschaft, trotz gelegentlicher Extrembeispiele, dauerhaft auch eher freiwillig ist. In Freikirchen, Neuapostolischer Kirche usw. sind die Kirchen gefüllt, während in den Amtskirchen eine immer stärker werdende Leere herrscht.
Selbiges gilt für die zunehmend sich entwickelnden Berufsspartengewerkschaften im Vergleich zu den "Amtsgewerkschaften", wie ich sie einmal etwas süffisant nennen möchte.
In den beiden Amtskirchen arbeiten die Leute gegen Bezahlung, in den anderen Kirchen überwiegend ehrenamtlich.
Trotzdem stehen letztere im Prinzip besser da.
Bei vielen Unternehmen, vor allem größeren, war es nach WKII Usus, dass vor Aushändigung des Arbeits- oder Ausbildungsvertrags die Beitrittserklärung zur zuständigen Gewerkschaft vorgelegt wurde und sich der Bewerber in einer Situation befand, in der er sich bedrängt fühlte, diese zu unterschreiben.
Das hatte den Vorteil für die Gewerkschaften, dass sie ausreichend Mitglieder und damit Druckpotential bei Tarifverhandlungen hatten, was in Folge erst einmal auch zu vergleichsweise hohen Tarifabschlüssen führte.
Dies war jedenfalls die Situation im Westen, wo faktisch nicht der Staat die Tarifbedingungen vorgab.
Bei den Kirchen war das ähnlich. Die Taufe war ein gesellschaftlich vorgegebenes Standardritual nach der Geburt von Kindern, der man im allgemeinen nicht auswich, um nicht im Abseits zu stehen. Ursprünglich fand die Christianisierung allerdings noch unter weitaus intensiveren Druckbedingungen statt.
Nach WKII war die Situation in der sozialistischen und damit eher kirchenfeindlichen DDR umgekehrt, aber im Kern trotzdem ähnlich. Hier wurde halt eher erwartet, dass man NICHT in der Kirche ist.
Dem Vorteil der beiden Amtskirchen einer hohen Mitgliedsrate standen diverse Nachteile gegenüber.
Dazu gehört schon einmal, dass sich in einer Situation der Freiwilligkeit dauerhaft überwiegend die Menschen in den Kirchen organisieren, die auch zur christlichen Idee und Lehre selbst stehen wollen und können.
Meine These mag manchen Leuten ein wenig gewagt erscheinen, aber ich denke, dass die meisten kritischen Entwicklungen und Skandale der beiden Amtskirchen vor allem daher rühren, dass weite Teile der Kirchenmitglieder eher unfreiwillig Christen waren und es genau diese Unfreiwilligen waren, welche die ursprüngliche christliche Idee konterkarierten.
Solch große Organisationen mit einer hohen gesellschaftlichen Verbreitung schaffen natürlich Anreize für primär karrieristisch orientierte Menschen, denen es nicht um die Idee geht, die der Organisation eigentlich zugrunde liegt, sondern um ihren ganz persönlichen Vorteil.
Die zunehmend säkulare Welt identifiziert aber fälschlicherweise die kritischen Entwicklungen innerhalb der Kirchen und deren Skandale mit der Kirche an sich und der christlichen Idee, während es gerade die mit einer Zwangsmitgliedschaft einhergehende interne Säkularisierung war, welche der Boden für die diversen Skandale war.
Was viele nicht wissen, ist beispielsweise die Tatsache, dass Rom während und nach dem Mittelalter überwiegend gegen Hexenverbrennungen agierte und diese eher ein Phänomen des säkularen Teils Europas war, genauso wie die Initiative zur konkreten Hexenverbrennung selbst innerhalb der von den Kirchen geprägten Regionen überwiegend säkular geprägt war.
Nun haben die beiden Amtskirchen ein riesiges, logistisches Netz, das noch aus den Zeiten herrührt, in denen fast alle Bürger gezwungenermaßen Kirchenmitglieder und damit auch Kirchensteuerzahler waren, während gleichzeitig eine zunehmende Entwicklung hin zu Kirchenaustritten stattfindet, was dazu führt, dass ohne externe Subventionierung dieses große Netz gar nicht mehr finanzierbar ist.
Bei EKD und RKK ist die Mitgliederentwicklung im Prinzip ähnlich, d.h. deutlich rückläufig.
Beide Amtskirchen fahren eine durchaus unterschiedliche Strategie, konnten aber beide den Mitgliederschwund damit nicht aufhalten. Während die EKD eher eine Adaptionsstrategie fährt, d.h. sich insgesamt eher an das Denken der jeweiligen Zeit anpasst und dadurch ihre religiöse Substanz zu verlieren droht, hält die RKK zuweilen geradezu krampfhaft an Ideen fest, die kaum ein moderner Mensch noch mittragen will und kann, behält aber dadurch eher noch das Image einer von der säkularen Welt abgrenzbaren christlichen Organisation.
Man mag nun einwenden, dass in anderen Ländern, vor allem denen der Dritten Welt, die Mitgliederentwicklung teilweise eher umgekehrt ist oder wenigstens einigermaßen stabil. Dabei sollte man aber nicht unterschlagen, dass die christlichen Kirchen der Dritten Welt überwiegend durch die Mitgliedsbeiträge der Kirchen aus den reichen Ländern finanziert werden. Insofern darf man sich fragen, inwieweit die Entwicklungen in der Dritten Welt nicht dieselben wie in den reichen, westlichen Ländern wären, wenn die Subventionen wegfallen würden und sich die dortigen Kirchen eigenständig finanzieren müssten. Wer hat in Ländern, in denen Armut herrscht, schon Geld für Kirchenbeiträge übrig?
Ich komme an diesem Punkt noch einmal auf die Gewerkschaften zurück, weil auch auf einer anderen Ebene zusätzlich eine Entwicklung stattfand, die es auch bei den Amtskirchen gab und die ebenfalls Ursache für zunehmende Mitgliedererosion ist.
Gewerkschaften haben eigentlich primär den Zweck, für ihre Mitglieder möglichst optimale Arbeits- und Tarifbedingungen durchzusetzen. Das ist dei Ursache, weshalb sich Arbeitnehmer ursprünglich kollektiv organisierten. Die Chancen stehen je besser, desto mitgliederstärker die jeweilige Gewerkschaft ist.
Vor allem in den vergangenen Jahrzehnten versuchten sich die Gewerkschaften aber zunehmend als politische Kraft zu positionieren. Der Bürger nimmt deshalb Gewerkschaften immer stärker als Organisation mit bestimmten politischen Botschaften wahr. In der Regel sind das eher politisch linke Botschaften. Mittel- und unmittelbar sind die Gewerkschaften zum verlängerten Arm der SPD geworden, was unter anderem dazu führte, dass die Gewerkschaftsspitze vor Wahlen mehr oder weniger offen die SPD oder linke Parteien unterstützt.
Der Bürger hat aber in seiner Funktion als Arbeitnehmer erst einmal primär Arbeitnehmerinteressen, und zwar gleichgültig welche sonstigen, politischen Ansichten er vertritt. Der CDU- der FDP-Wähler, der Arbeitnehmer ist, bleibt natürlich Arbeitnehmer und hat trotz einer eher konservativen oder liberalen Grundeinstellung in seiner Funktion als Arbeitnehmer natürlich bestimmte persönliche Interessen, die erst einmal wenig mit seinen politischen Ansichten zu tun haben.
Eine Gewerkschaft, die sich aber zunehmend als politische Organisation präsentiert und dabei mehr oder weniger offen für Parteien wirbt, für die einzelne Arbeitnehmer so gar kein Herz haben, die muss natürlich damit leben, dass Arbeitnehmer sich auch zunehmend nicht mehr in der Stammgewerkschaft organisieren oder aus dieser austreten, wenn deren grundsätzliche, politische Haltung eine andere als die ist, welche die Gewerkschaftsspitze vorgibt. Warum sollte man bereit sein, eine Organisation mit Beiträgen zu unterstützen, die offen für Parteien wirbt, die man selbst als politischen Gegner betrachtet?
Ich selbst bin derzeit in einem Unternehmen beschäftigt, das noch eine vergleichsweise hohe gewerkschaftliche Organisationsdichte hat, was auch dazu führt, dass unsere Tarifabschlüsse im allgemeinen etwas höher sind als im gesamtdeutschen Durchschnitt.
Wenn ich nun aber die Kollegen betrachte, die nicht in der Gewerkschaft sind und deren Motive, dann lassen sich diese im wesentlichen auf zwei Gründe reduzieren. Man ist politisch eher konservativ bis liberal, weshalb man die klare Parteinahme der Gewerkschaft für bestimmte Parteien nicht mittragen und unterstützen möchte und man findet, dass die Gewerkschaften ihre ureigenste Aufgabe, eine Interessenvertretung für die Arbeitnehmer zu sein, zunehmend vernachlässigen und sich auf ihre neue Funktion als politische Kraft reduzieren.
Bei den Amtskirchen findet unter umgekehrten politischen Vorzeichen eigentlich die gleiche Entwicklung statt. Die Kirchen, vor allem die RKK, positioniert sich politisch und wirbt bzw. warb traditionell eher für die rechten bzw. konservativen Parteien. Die Tatsache, dass sich der Einzelne als Christ betrachtet, hat aber nicht zwingend etwas mit seiner grundsätzlich politischen Einstellung zu tun. Die Vorstellung, man könne als Christ nicht die Linke oder die SPD wählen, ist genauso absurd wie die Vorstellung, man müsse genau diese Parteien wählen, wenn man Arbeitnehmer ist.
Die Mitgliedererosion bei den Amstkirchen geht deshalb auch zu einem erheblichen Teil von politisch eher links orientierten Bürgern aus.
Sowohl Gewerkschaften wie auch Kirchen müssen grundsätzlich akzeptieren und sich auch darauf einstellen, dass mit einer faktisch freiwilligen Mitgliedschaft bis zu einem gewissen Grad auch ein Rückgang der Mitgliederzahl verbunden sein kann und man muss sich fragen, ob man das bisherige "Vertriebsnetz" unter solchen Bedingungen noch aufrecht erhalten kann und will.
Gleichzeitig müssen sie sich aber auch entscheiden, ob sie eher eine politische Kraft sein wollen oder eine Interessenvertretung für ihre durchaus politisch unterschiedlich orientierten Mitglieder.
Überleben christliche Kirchen und Gewerkschaften die Neuzeit
Moderator: Moderatoren Forum 1
Re: Überleben christliche Kirchen und Gewerkschaften die Neu
Soviel geschrieben und keiner antwortet 
Thema belanglos
Thema belanglos
Politik ist wie eine Hure,die kann man nehmen wie man will
Re: Überleben christliche Kirchen und Gewerkschaften die Neu
Wer liest schon so viel Quark?