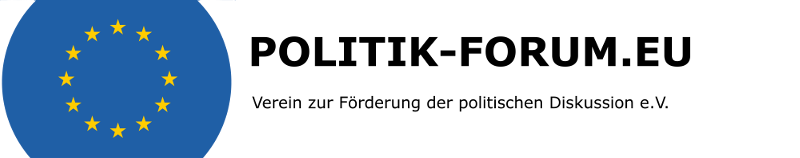Eigentlich besiedelten schon Ende des 17, Jahrhunderts, nach dem Rückzug der Türken Deutsche den geographischen Raum längs des Mittellaufs der Donau. Gebiete, die damals hauptsächlich zum Köngreich Ungarn, heute teilweise auch zu Rumänien und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens gehören. Das Jahr 1712 markiert jedoch den Beginn systematischer und zwischen europäischen Herrschern abgestimmten Besiedelung. Große, flache, floßartige Flussschiffe brachten in der Regel von Ulm aus startend verarmte, abenteuerlustige, religiös verfolgte, teilweise auch strafersatzwillige Deutsche mitsamt Hab und Gut die Donau flußabwärts. Natürlich nicht nur "Schwaben" sondern auch Hessen, Bayern, Franken, Böhmen etc. Lediglich die heute am Dreiländereck Ukraine/Ungarn/Rumänien um die Stadt Sathmar (heute rumänisch Satu Mare) Angesiedelten waren Schwaben im engeren Sinne.
Im zweiten Weltkrieg standen viele der Donauschwaben auf Seiten der (Reichs)Deutschen und wurden in den Jahren nach dem Kriegsende entweder - in Abstimmung mit den Allierten - nach Deutschland zurückverfrachtet (wie zum Beispiel die Familie des Vaters von Joschka Fischer) oder mehr oder minder zwangsassimiliert. Besonders aus Rumänien wanderten Deutsche im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahhrunderts zurück nach Deutschland. In Rumänien gibt es mitterweile zahlenmäßig nur noch ein paar ganz wenige von den ursprünglichen Siedlern abstammende Familien.
Wenn aber etwa aus Anlass des 300-Jahres-Jubiläums zum "Tag der Sathmarer Schwaben" in Ulm große Feste mit vielen Gästen aus dem Sathmarer Raum gefeiert werden, bei denen Dutzende junger Menschen Paraden und Volkstänze in traditionellen Schwabentrachten aufführen, wundert man sich deshalb erstmal. Es handelt sich zumeist um Mitglieder von Vereinen wie der "Jugendorganisation Gemeinsam" aus Satu Mare, jungen Rumäninnen und Rumänen zuallermeist, die am Gymnasium Deutsch als Fremdsprache lernen und es amüsant finden, Trachtentänze zu lernen und sie im fernen Deutschland aufzuführen. Schon morgen werden es die kleinen virtuellen Schwaben vielleicht amüsanter finden, sich mit japanischem Cosplay zu befassen oder Irish Folk Bands zu gründen.
Die erste These ist: Das was früher als "Kultur" identitätsstiftend, prägend und mit Ethnie, Blut und Territorium verknüpft war, ist heute zunehmend eine reine Konstruktion. Das "Donauschwabentum" als Kultur hat sich nicht aufgelöst, es wurde nur virtualisiert. Sprich: Die Kultur wurde von ihren TrägerInnen und ihrem Verbreitungsgebiet gelöst und ist als Konstruktion nun für jeden verfügbar.
In eine ähnliche Richtung - mit anderer Beispielkultur - zielt übrigens der hochinteressante Sammelband "Der virtuelle Jude. Die Konstruktion des Jüdischen" von 2005. (http://buecher.hagalil.com/studienverlag/hoedl.htm)
Und die zweite These ist: Alll dies ist eine höchst erfreuliche Entwicklung und sollte auf jede denkbare Weise befördert werden.
Gegenstimmen?
300 Jahre Donauschwaben
Moderator: Moderatoren Forum 7
- schokoschendrezki
- Beiträge: 20818
- Registriert: Mittwoch 15. September 2010, 16:17
- user title: wurzelloser Kosmopolit
- Wohnort: Berlin
- Kontaktdaten:
300 Jahre Donauschwaben
Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt ... ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig (Hannah Arendt)
- Progressiver
- Beiträge: 2656
- Registriert: Sonntag 1. April 2012, 00:37
- Wohnort: Baden-Württemberg
Re: 300 Jahre Donauschwaben
Ja, meine. Ich bin selbst im rumänischen Teil des Banats geboren und habe eine andere Meinung dazu. Natürlich hat sich das, was Du beschrieben hast, zunehmend virtualisiert. Aber andererseits gibt es auch Auflösungserscheinungen, so daß das, was mal als donauschwäbische Kultur galt, immer mehr verschwindet.schokoschendrezki » Do 25. Okt 2012, 16:46 hat geschrieben: Die erste These ist: Das was früher als "Kultur" identitätsstiftend, prägend und mit Ethnie, Blut und Territorium verknüpft war, ist heute zunehmend eine reine Konstruktion. Das "Donauschwabentum" als Kultur hat sich nicht aufgelöst, es wurde nur virtualisiert. Sprich: Die Kultur wurde von ihren TrägerInnen und ihrem Verbreitungsgebiet gelöst und ist als Konstruktion nun für jeden verfügbar.
In eine ähnliche Richtung - mit anderer Beispielkultur - zielt übrigens der hochinteressante Sammelband "Der virtuelle Jude. Die Konstruktion des Jüdischen" von 2005. (http://buecher.hagalil.com/studienverlag/hoedl.htm)
Und die zweite These ist: Alll dies ist eine höchst erfreuliche Entwicklung und sollte auf jede denkbare Weise befördert werden.
Gegenstimmen?
Meine nach Österreich-Ungarn ausgewanderte Vorfahren kamen übrigens vermutlich aus den heutigen Gebieten des Schwarzwaldes, des französischen Elsaß, vermutlich auch Rheinland-Pfalz sowie aus dem Saarland.
Ob diese "Virtualisierung" eine höchst erfreuliche Entwicklung darstellt, ist mir jedoch egal. Ich bin schon als Kind nicht gerne auf Trachtenfeste mit Volksmusik gegangen, habe also mit "der donauschwäbischen Kultur" nicht viel am Hut. Außerdem bin ich ein kritischer Geist und hierzulande ganz anders sozialisiert worden. Katholisch sind in meiner Generation viele nicht mehr. Ich wüßte also nicht, was viel bleiben wird.
MfG
"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." Friedrich Nietzsche
"Wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, dem wird bald jedes Problem zum Nagel."
"Wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, dem wird bald jedes Problem zum Nagel."
- schokoschendrezki
- Beiträge: 20818
- Registriert: Mittwoch 15. September 2010, 16:17
- user title: wurzelloser Kosmopolit
- Wohnort: Berlin
- Kontaktdaten:
Re: 300 Jahre Donauschwaben
Es fällt mir jetzt allerdings nicht ganz leicht, diesen Beitrag tatsächlich als Gegenstimme zu interpretieren. Ich lese das eher als Bekenntnis zur Indifferenz.Progressiver » Do 25. Okt 2012, 19:20 hat geschrieben:
Ja, meine. Ich bin selbst im rumänischen Teil des Banats geboren und habe eine andere Meinung dazu. Natürlich hat sich das, was Du beschrieben hast, zunehmend virtualisiert. Aber andererseits gibt es auch Auflösungserscheinungen, so daß das, was mal als donauschwäbische Kultur galt, immer mehr verschwindet.
Meine nach Österreich-Ungarn ausgewanderte Vorfahren kamen übrigens vermutlich aus den heutigen Gebieten des Schwarzwaldes, des französischen Elsaß, vermutlich auch Rheinland-Pfalz sowie aus dem Saarland.
Ob diese "Virtualisierung" eine höchst erfreuliche Entwicklung darstellt, ist mir jedoch egal. Ich bin schon als Kind nicht gerne auf Trachtenfeste mit Volksmusik gegangen, habe also mit "der donauschwäbischen Kultur" nicht viel am Hut. Außerdem bin ich ein kritischer Geist und hierzulande ganz anders sozialisiert worden. Katholisch sind in meiner Generation viele nicht mehr. Ich wüßte also nicht, was viel bleiben wird.
MfG
Wobei viele Kulturpraktiken, von denen wir meinen, sie seien "verschwunden" tatsächlich in anderer Form ziemlich lebendig sind. Nehmen wir einmal den Jazz, der bereits Ende des 19.. Jahrhunderts aus der gewissermaßen virtualisierten afro-amerikanischen Musiktradition schwarzer Sklaven sowie traditionellen franzöischen und spanischen Einflüssen entstand. Ein so prägendes aktuelles und gegenwärtiges Phänomen wie das Leitbild der Coolness wurde ganz maßgeblich durch die Ästhetik und Aufführungspraxis von Jazz geprägt.
So relevant wird der kulturelle Einfluss des Donauschwäbischen wohl kaum werden. Aber immerhin: Mit der Literatur-Nobelpreisverleihung an die Banater Schwäbinn Herta Müller drang so etwas wie eine Kultur des Grenzgängertums und der programmatischen Heimatlosigkeit von Temeschburg in die Welt. Ihr Werk ist heute selbst in China in einer mehrbändigen Gesamtausgabe erschienen.
Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt ... ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig (Hannah Arendt)