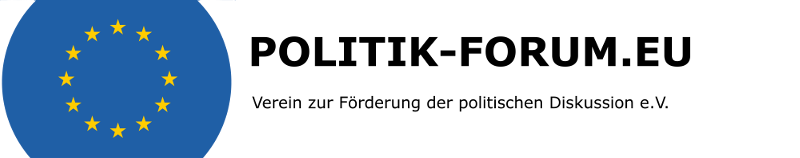Verfall im Bankenviertel
12.08.2012 · Banker wetten gegen Kunden, waschen Geld und drehen am Zins. Aber wo sie sich verzockt haben, wurden sie mit Staatsgeld gerettet. Was ist bloß in die Leute gefahren?
Keine Woche vergeht, ohne dass ein neuer Bankenskandal für Schlagzeilen sorgt. Die Schweizer UBS soll Kunden in Deutschland zur Steuerhinterziehung verführt und eigens entsprechende Schulungsunterlagen für ihre Berater entworfen haben. Die englische Bank Standard Chartered steht im Verdacht, in illegale Finanzgeschäfte mit Iran verwickelt zu sein - sie könnte damit die Sicherheitsinteressen des Westens gefährdet haben. Und HSBC, nach Bilanzsumme die größte Bank Europas, hat offenbar über Jahre hinweg mexikanischen Drogenbaronen bei der Geldwäsche geholfen.
Die Banker sind von der Rolle. Die weitesten Kreise ziehen derzeit die Ermittlungen um die Manipulation des Bankenzinses Libor. Mehr als ein Dutzend Banken sollen diesen Referenzzins für Kredite, Sparprodukte und Wertpapiere überall auf der Welt künstlich nach oben und unten getrieben haben - ganz wie es ihnen für ihre Geschäfte passte. Selbst Mitarbeiter der Deutschen Bank stehen im Verdacht, beteiligt gewesen zu sein.
Die Banker werden stigmatisiert
Der Fall ist tricky: Selbst Menschen, die überhaupt keine Geschäftsbeziehung mit der jeweiligen Bank hatten, können unter der Zinsmanipulation gelitten haben: weil die Zinsen ihres Hauskredits, ihres Sparkontos oder ihres Wertpapiers an den Libor als Referenzzins gekoppelt waren. Nicht mehr der dumme Kunde, der ein Bankprodukt nicht verstanden hat, ist das Opfer der Banken. Sondern unbeteiligte Dritte.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen den vielen Fällen? Warum sind es immer wieder die Banker, die alle Welt an Kapitalismus und Marktwirtschaft verzweifeln lassen? Häufig zu hören ist: Weil die Aufsichtsbehörden sich seit der Finanzkrise weltweit in einem Wettlauf darum befinden, Bankenskandale aufzudecken. Besonders in Amerika, wo sich gleich mehrere Behörden um den Titel des brutalstmöglichen Aufklärers bewerben, will man Schuldige bestraft sehen. Entsprechend wurden die Aktivitäten der Aufsichtsbehörden erheblich ausgeweitet. Justitia freut’s.
Doch diese Antwort ist zu schlicht. Wichtiger noch ist: Die Banker werden stigmatisiert. Aber die Banken werden ständig gerettet. Es rächt sich, dass die reinigende Kraft der Krise außer Kraft gesetzt wurde. Überall auf der Welt schrumpfen Banken zwar - aber sie verschwinden nicht aus dem Markt. Der in einer Marktwirtschaft normale Prozess, dass gescheiterte Unternehmen abtreten, ist blockiert: Wo sich Banker verzockt haben, wurden sie mit Staatsgeld gerettet. Zudem sorgt die Geldflut der Europäischen Zentralbank dafür, dass Banken am Leben erhalten werden, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte.
Die Banken haben fürstlich bezahlt
Die spanische Bankia ist so ein Fall. Obwohl die Bank mit Milliarden vom Staat gerettet werden musste und sie Spanien immer tiefer in den Schuldensumpf zog, stopften die Verantwortlichen sich die Taschen voll. Für Empörung im Land sorgte vor allem die Millionenabfindung für Bankpräsident Rodrigo Rato, der seinen Abschied mit einer ausgelassenen Party feierte. Ein Skandal: Denn die anderen Euroländer mussten für Spaniens Banken einspringen.
Vor allem die großen Banken wussten, dass die Staaten sie nicht würden fallen lassen können („Too big to fail“). Und gingen deshalb besonders hohe Risiken ein. Auf 34 Milliarden Dollar im Jahr haben Analysten die Extrarendite aus diesen riskanten Geschäften allein für die 18 größten Banken der Welt geschätzt - 1,8 Milliarden für jede.
Die Aufblähung des Finanzsektors hatte Auswirkungen auch auf die Rekrutierung von Mitarbeitern, wie Untersuchungen der Ökonomen Stephen Cecchetti und Enisse Kharroubi von der Internationalen Bank für Zahlungsausgleich zeigen. Die Banken gewannen außergewöhnlich viele hochqualifizierte junge Mitarbeiter. Und sie haben sie fürstlich bezahlt. Die guten Verdienstmöglichkeiten zogen besonders tüchtige Leute an - aber offenbar auch solche, die beim Geldverdienen recht rücksichtslos vorgingen.
Verschärfung der Vorschriften für die Eigenkapitalausstattung
Viele Politiker verlangen jetzt strengere Regeln für die Banken. Das Thema könnte sogar - neben dem Euro - den nächsten Bundestagswahlkampf beherrschen.
Strengere Regulierung fordert sich leicht - so richtig weiß aber keiner, was die beste Regulierung ist. Denn die Finanzindustrie war immer schon eine der am stärksten regulierten Branchen überhaupt. Vielleicht aber ging die Regulierung bisweilen in die falsche Richtung? So gibt es strenge Vorschriften, dass Banken für ihre Risiken Eigenkapital vorhalten müssen. Die Idee ist, dass Banken einen Puffer für mögliche Ausfälle haben sollen. Zugleich soll diese Vorschrift die Möglichkeit einer Bank, Risiken einzugehen, nach oben begrenzen.
Ausgerechnet aber für europäische Staatsanleihen gibt es eine Ausnahme: Für sie muss kein Eigenkapital vorgehalten werden. So musste viel Eigenkapital für Kredite an kleine Unternehmen gehalten werden - und nichts für Kredite an südeuropäische Staaten.
[...]
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/s ... 52492.html