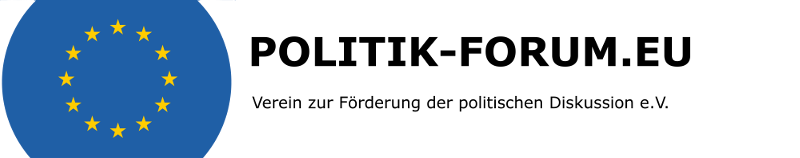Geschichte des Sports
Moderator: Moderatoren Forum 6
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Geschichte des Sports
Hallo, die Sportgeschichte gehörte von Anfang an zu den wichtigsten Disziplinen der Sportwissenschaft, weil sie sich mit dem Blick in die Vergangenheit beschäftigt und weil sich mit dem Wissen über diese Vergangenheit auch die Gegenwart von Turnen und Sport rechtfertigen ließen.
Es ist eine absolut interessante Sache mehr über die Geschichte des Sports zu erfahren.
Wie wichtig die Kenntnis und Erforschung der Geschichte für die Entwicklung des modernen Sports und der Sportwissenschaft waren, zeigt Baron Pierre de Coubertin als auch Carl Diem.
Für Coubertin waren der Olympismus und die modernen Olympischen Spiele unmittelbar mit der Geschichtsschreibung verbunden. Auch Carl Diem suchte weit in der Vergangenheit nach Vorläufern und Vorbildern der modernen Sportwissenschaft (Platon, Aristoteles, Philostratos und andere antike Gelehrte und Philosophen).
Die Turnpioniere des 19. Jahrhunderts, die den Grundstein für die Sportwissenschaft legten, bemühten sich deshalb besonders um eine Erforschung der Leibes- und Bewegungskultur in der griechischen Antike.
Sportgeschichte spielt auch in der Tradition der Fussball - sowie Turn -und Sportvereine eine sehr wichtige Rolle.
Hier sollten aus allen Sportarten Beiträge zur Geschichte des Sports ihren Platz finden.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Es ist eine absolut interessante Sache mehr über die Geschichte des Sports zu erfahren.
Wie wichtig die Kenntnis und Erforschung der Geschichte für die Entwicklung des modernen Sports und der Sportwissenschaft waren, zeigt Baron Pierre de Coubertin als auch Carl Diem.
Für Coubertin waren der Olympismus und die modernen Olympischen Spiele unmittelbar mit der Geschichtsschreibung verbunden. Auch Carl Diem suchte weit in der Vergangenheit nach Vorläufern und Vorbildern der modernen Sportwissenschaft (Platon, Aristoteles, Philostratos und andere antike Gelehrte und Philosophen).
Die Turnpioniere des 19. Jahrhunderts, die den Grundstein für die Sportwissenschaft legten, bemühten sich deshalb besonders um eine Erforschung der Leibes- und Bewegungskultur in der griechischen Antike.
Sportgeschichte spielt auch in der Tradition der Fussball - sowie Turn -und Sportvereine eine sehr wichtige Rolle.
Hier sollten aus allen Sportarten Beiträge zur Geschichte des Sports ihren Platz finden.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Den Anfang mache ich einmal mit Fussball. Heute jährt sich das Finalspiel des 1. deutschen Pokalspieles zum 75. mal.
Am 8. Dezember 1935 fand im Düsseldorfer Rheinstadion das 1. Finale des Tschammerpokales statt.
Erster Pokalsieger wurde der 1. FC Nürnberg, der sich gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 durchsetzen konnte.
Mit dem Tschammerpokal 1935 wurde zum ersten Mal ein nationaler Pokalwettbewerb im deutschen Fußball ausgetragen. Er wurde nach dem damaligen Reichssportführer und Pokalstifter Hans von Tschammer und Osten benannt. Für Spiele, die auch nach Verlängerung unentschieden endeten, wurde ein Wiederholungsspiel angesetzt.
Zwischen dem 6. Januar und dem Finale am 8. Dezember 1935 nahmen insgesamt etwa 4100 Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Gauliga am ersten Wettbewerb teil. In der 1. Runde spielten nur die 2.952 Kreisklasse-Mannschaften gegeneinander. Die Sieger trafen in der 2. Runde auf die etwa 1000 Mannschaften aus den Bezirksklassen. Die erste von drei Hauptrunden begann am 11. Mai mit vier regionalen Gaugruppen unter erstmaliger Beteiligung der Gauligisten, wobei die Gaumeister ein Freilos erhielten. Die ersten deutschlandweiten Paarungen begannen am 1. September mit der 1. Schlussrunde.
Bis 1943 wurde der Tschammerpokal ausgetragen. Die Finalpaarungen/Ergebnisse lauteten:
1936: VfB Leipzig - FC Schalke04 2:1
1937: FC Schalke04 - Fortuna Düsseldorf 2:1
1938: SK Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1
1939: 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0
1940: Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1
1941: Dresdner SC - FC Schalke04 2:1
1942: TSV 1860 München - FC Schalke04 2:0
1943: Vienna Wien - Luftwaffen SV Hamburg 3:2.
Quelle: Hardy Grüne, Matthias Weinrich (2001): Deutsche Pokalgeschichte. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 6, S. 10 - 15, AGON Sportverlag Kassel.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Am 8. Dezember 1935 fand im Düsseldorfer Rheinstadion das 1. Finale des Tschammerpokales statt.
Erster Pokalsieger wurde der 1. FC Nürnberg, der sich gegen den FC Schalke 04 mit 2:0 durchsetzen konnte.
Mit dem Tschammerpokal 1935 wurde zum ersten Mal ein nationaler Pokalwettbewerb im deutschen Fußball ausgetragen. Er wurde nach dem damaligen Reichssportführer und Pokalstifter Hans von Tschammer und Osten benannt. Für Spiele, die auch nach Verlängerung unentschieden endeten, wurde ein Wiederholungsspiel angesetzt.
Zwischen dem 6. Januar und dem Finale am 8. Dezember 1935 nahmen insgesamt etwa 4100 Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Gauliga am ersten Wettbewerb teil. In der 1. Runde spielten nur die 2.952 Kreisklasse-Mannschaften gegeneinander. Die Sieger trafen in der 2. Runde auf die etwa 1000 Mannschaften aus den Bezirksklassen. Die erste von drei Hauptrunden begann am 11. Mai mit vier regionalen Gaugruppen unter erstmaliger Beteiligung der Gauligisten, wobei die Gaumeister ein Freilos erhielten. Die ersten deutschlandweiten Paarungen begannen am 1. September mit der 1. Schlussrunde.
Bis 1943 wurde der Tschammerpokal ausgetragen. Die Finalpaarungen/Ergebnisse lauteten:
1936: VfB Leipzig - FC Schalke04 2:1
1937: FC Schalke04 - Fortuna Düsseldorf 2:1
1938: SK Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1
1939: 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0
1940: Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1
1941: Dresdner SC - FC Schalke04 2:1
1942: TSV 1860 München - FC Schalke04 2:0
1943: Vienna Wien - Luftwaffen SV Hamburg 3:2.
Quelle: Hardy Grüne, Matthias Weinrich (2001): Deutsche Pokalgeschichte. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 6, S. 10 - 15, AGON Sportverlag Kassel.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, in Frankfurt am Main gründete sich am 17. Dezember 1911 der Deutsche Fechter-Bund. Zu seinen Gründungsmitgliedern gehörten der Gauverband Mittelrheinischer Fechtklubs, der Verband niederrheinischer Fechtvereine und der Norddeutsche Fechterbund sowie einzelne Vereine und sogar Einzelpersonen. Sein Zweck war die Vereinigung Deutscher Fechterverbände, -vereine und Einzelfechter, die Abhaltung von Turnieren auf nationaler Ebene und die Vertretung deutscher Interessen im Ausland.
Der Deutsche Fechter-Bund e. V. (DFB) ist der deutsche Dachverband für den Fechtsport nach den Regeln der FIE. Zu seinen Aufgaben gehört:
1. den Fechtsport zu fördern und zu verbreiten,
2. die Aus- und Weiterbildung von Fechttrainern,
3. die Landesfachverbände und deren Mitglieder zu beraten und die Zusammenarbeit der Landesfachverbände zu fördern,
4. die jugendpflegerische Arbeit nach Kräften zu unterstützen
5. die Einhaltung seiner Regeln und Regeln der Verbände, denen der DFB angehört, zu überwachen, 6. Verstöße dagegen zu ahnden und seine Mitglieder hierzu zu verpflichten,
7. ein amtliches Organ (der „fechtsport“) herauszugeben.
Der Deutsche Fechter-Bund wird von einem Präsidium mit sechs Mitgliedern geleitet. Das höchste Organ des Verbandes ist der Deutsche Fechtertag, der alle zwei Jahre zusammen tritt. In den Jahren ohne Deutschen Fechtertag übernimmt der Hauptausschuss Teile seiner Aufgaben. Seine Verbandsgerichtsbarkeit erfüllt der DFB mit einem Schiedsgericht und einem Disziplinargericht.
Für die inhaltliche Arbeit gibt es verschiedene ständige Ausschüsse:
Sportausschuss
Jugendausschuss
Ausschuss für das Kampfrichterwesen
Ausschuss für Medizin
Zur Unterstützung seiner Arbeit hat das Präsidium weitere Ausschüsse eingerichtet:
Ausschuss für Lehrwesen und Trainingswissenschaft
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Die „Neuordnung des Deutschen Sports“ wurde am 24. Mai 1933 verfügt. Bereits ab Sommer 1933 wurden die Aufgaben des DFB vom Fachamt Fechten des „Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen“ wahrgenommen. Am 17. Dezember 1945 wurde das Fechten von den Zonenbefehlshabern der Besatzungsmächte in der Direktive Nr. 23 („Beschränkung und Entmilitarisierung des Sportwesens in Deutschland“) verboten.
Am 27. November 1949 wurde – nach Aufhebung des Verbots durch die Alliierten – der Deutsche Fechter-Bund e. V. mit Sitz in Bonn erneut gegründet.
1973 holte die deutsche Mannschaft bei der WM sensationell Gold und sorgte für das „Wunder von Göteborg“. 1976 veredelte Degengenie Alexander Pusch seinen WM-Erfolg von 1975 mit dem Olympiasieg in Montreal. Puschs Vereinskollege Jürgen Hehn sicherte sich die Silbermedaille. Den großen olympischen Coup landete auch das Herrenflorettteam, zu dem im übrigen Thomas Bach gehörte, der später als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und heute als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) seine Karriere auf sportpolitischer Ebene fortsetzte.
Der Tauberbischofsheimer Arnd Schmitt, heute Zahnarzt in Bergisch Gladbach, gewann 1988 die olympische Goldmedaille. Diese Spiele in Südkorea waren schlechthin der Höhepunkt des deutschen Fechtsports. Dazu trugen vor allem die Florettdamen Anja Fichtel, Sabine Bau und Zita Funkenhauser bei, die in dieser Reihenfolge Gold, Silber und Bronze sowie gemeinsam noch einmal Mannschafts-Gold holten. Dieses Frauentrio war die schlagkräftigste Gemeinschaft, die das deutsche Fechten jemals hervorgebracht hat.
Die Offenbacherin „Conny“ Hanisch schrieb mit den Siegen 1979, 1981 und 1985 eine WM-Titeltrilogie und freute sich 1986 über die Wahl zur „Sportlerin des Jahres“.
Im Herrenflorett der Beste in der Welt zu werden, wird von vielen als die Krone des Fechtsports bezeichnet. Geschafft haben dies vier deutsche Athleten: als Erster Friedrich Wessel 1969 und 1970, 1987 dann Mathias Gey, 1989 und 1993 Alexander Koch sowie 1991 Ingo Weißenborn.
Nur ein Deutscher konnte hingegen die Nummer Eins im Säbel werden; nämlich Felix Becker, der 1994 in Athen Weltmeister wurde.
Enttäuschend war die Medaillenausbeute bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta. Einzig das Damenflorett-Team griff nach Bronze. Vier Jahre später lief es wieder besser: Ralf Bißdorf gewann Silber im Herrenflorett-Einzel; Rita König und Willy Kothniy freuten sich über Bronze. Kothny holte mit der Säbelmannschaft nochmals Bronze. 2004 in Athen erfocht sich die Damendegenmannschaft die Silbermedaille, das Herrendegen-Team gewann Bronze.
Aber auch bei Weltmeisterschaften blieben die Deutschen Fechterinnen an der Spitze. Sabine Bau durfte sich 1998 in der Schweiz über Gold freuen, Claudia Bokel setzt sich ausgerechnet in Frankreich 2001 gegen Laura Flessel durch und 2003, sowie 2006 schlug der Koblenzer Peter Joppich zu. Joppich gehört gemeinsam mit dem Bonner Benjamin Kleibrink zu den potentiellen Medaillenkandidaten.
Quelle: Teile aus: FECHTTRAINING von Barth/Beck (Hrsg.), A. Schirmer, Meyer & Meyer Verlag Aachen, 2000, Seiten 17 ff.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Der Deutsche Fechter-Bund e. V. (DFB) ist der deutsche Dachverband für den Fechtsport nach den Regeln der FIE. Zu seinen Aufgaben gehört:
1. den Fechtsport zu fördern und zu verbreiten,
2. die Aus- und Weiterbildung von Fechttrainern,
3. die Landesfachverbände und deren Mitglieder zu beraten und die Zusammenarbeit der Landesfachverbände zu fördern,
4. die jugendpflegerische Arbeit nach Kräften zu unterstützen
5. die Einhaltung seiner Regeln und Regeln der Verbände, denen der DFB angehört, zu überwachen, 6. Verstöße dagegen zu ahnden und seine Mitglieder hierzu zu verpflichten,
7. ein amtliches Organ (der „fechtsport“) herauszugeben.
Der Deutsche Fechter-Bund wird von einem Präsidium mit sechs Mitgliedern geleitet. Das höchste Organ des Verbandes ist der Deutsche Fechtertag, der alle zwei Jahre zusammen tritt. In den Jahren ohne Deutschen Fechtertag übernimmt der Hauptausschuss Teile seiner Aufgaben. Seine Verbandsgerichtsbarkeit erfüllt der DFB mit einem Schiedsgericht und einem Disziplinargericht.
Für die inhaltliche Arbeit gibt es verschiedene ständige Ausschüsse:
Sportausschuss
Jugendausschuss
Ausschuss für das Kampfrichterwesen
Ausschuss für Medizin
Zur Unterstützung seiner Arbeit hat das Präsidium weitere Ausschüsse eingerichtet:
Ausschuss für Lehrwesen und Trainingswissenschaft
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
Die „Neuordnung des Deutschen Sports“ wurde am 24. Mai 1933 verfügt. Bereits ab Sommer 1933 wurden die Aufgaben des DFB vom Fachamt Fechten des „Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen“ wahrgenommen. Am 17. Dezember 1945 wurde das Fechten von den Zonenbefehlshabern der Besatzungsmächte in der Direktive Nr. 23 („Beschränkung und Entmilitarisierung des Sportwesens in Deutschland“) verboten.
Am 27. November 1949 wurde – nach Aufhebung des Verbots durch die Alliierten – der Deutsche Fechter-Bund e. V. mit Sitz in Bonn erneut gegründet.
1973 holte die deutsche Mannschaft bei der WM sensationell Gold und sorgte für das „Wunder von Göteborg“. 1976 veredelte Degengenie Alexander Pusch seinen WM-Erfolg von 1975 mit dem Olympiasieg in Montreal. Puschs Vereinskollege Jürgen Hehn sicherte sich die Silbermedaille. Den großen olympischen Coup landete auch das Herrenflorettteam, zu dem im übrigen Thomas Bach gehörte, der später als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und heute als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) seine Karriere auf sportpolitischer Ebene fortsetzte.
Der Tauberbischofsheimer Arnd Schmitt, heute Zahnarzt in Bergisch Gladbach, gewann 1988 die olympische Goldmedaille. Diese Spiele in Südkorea waren schlechthin der Höhepunkt des deutschen Fechtsports. Dazu trugen vor allem die Florettdamen Anja Fichtel, Sabine Bau und Zita Funkenhauser bei, die in dieser Reihenfolge Gold, Silber und Bronze sowie gemeinsam noch einmal Mannschafts-Gold holten. Dieses Frauentrio war die schlagkräftigste Gemeinschaft, die das deutsche Fechten jemals hervorgebracht hat.
Die Offenbacherin „Conny“ Hanisch schrieb mit den Siegen 1979, 1981 und 1985 eine WM-Titeltrilogie und freute sich 1986 über die Wahl zur „Sportlerin des Jahres“.
Im Herrenflorett der Beste in der Welt zu werden, wird von vielen als die Krone des Fechtsports bezeichnet. Geschafft haben dies vier deutsche Athleten: als Erster Friedrich Wessel 1969 und 1970, 1987 dann Mathias Gey, 1989 und 1993 Alexander Koch sowie 1991 Ingo Weißenborn.
Nur ein Deutscher konnte hingegen die Nummer Eins im Säbel werden; nämlich Felix Becker, der 1994 in Athen Weltmeister wurde.
Enttäuschend war die Medaillenausbeute bei den Olympischen Sommerspielen in Atlanta. Einzig das Damenflorett-Team griff nach Bronze. Vier Jahre später lief es wieder besser: Ralf Bißdorf gewann Silber im Herrenflorett-Einzel; Rita König und Willy Kothniy freuten sich über Bronze. Kothny holte mit der Säbelmannschaft nochmals Bronze. 2004 in Athen erfocht sich die Damendegenmannschaft die Silbermedaille, das Herrendegen-Team gewann Bronze.
Aber auch bei Weltmeisterschaften blieben die Deutschen Fechterinnen an der Spitze. Sabine Bau durfte sich 1998 in der Schweiz über Gold freuen, Claudia Bokel setzt sich ausgerechnet in Frankreich 2001 gegen Laura Flessel durch und 2003, sowie 2006 schlug der Koblenzer Peter Joppich zu. Joppich gehört gemeinsam mit dem Bonner Benjamin Kleibrink zu den potentiellen Medaillenkandidaten.
Quelle: Teile aus: FECHTTRAINING von Barth/Beck (Hrsg.), A. Schirmer, Meyer & Meyer Verlag Aachen, 2000, Seiten 17 ff.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Am 19. Dezember 1909 wurde Borussia Dortmund gegründet.
Am 19. Dezember 1909, dem auch damals vierten Adventssonntag, trafen sich etwa 50 Mitglieder der Sodalität in einem Nebenraum des Wildschützes, um über die Gründung eines von der Kirche unabhängigen Sportvereins zu beraten.
Während des Treffens wurde heftig über die Trennung von der Gemeinde debattiert, eine Reihe der Teilnehmer verließ nach etwa einer Stunde die Sitzung und informierte Kaplan Dewald über die bevorstehende Gründung des Vereins. Dieser traf wenig später vor der Gaststätte ein, um die Sitzung aufzulösen, der Zutritt wurde ihm jedoch verweigert. Die 18 verbliebenen Personen – Franz und Paul Braun, Heinrich Cleve, Hans Debest, Paul Dziendzielle, Franz, Julius und Wilhelm Jacobi, Hans Kahn, Gustav Müller, Franz Risse, Fritz Schulte, Hans Siebold, August Tönnesmann, Heinrich und Robert Unger, Fritz Weber sowie Franz Wendt – gründeten noch am selben Abend den Verein.
Da die Gründung spontan und unvorbereitet ablief, gab es vor Beginn der Versammlung keine Namensvorschläge. Einer Anekdote zufolge wurde der Zusatz „Borussia“ gewählt, weil es sich um den Namen des im Wildschütz ausgeschenkten Bieres der Borussia-Brauerei handelte, die unweit des Borsigplatzes ihren Sitz hatte. Die Namenswahl ist daher wohl nicht als bewusster Ausdruck eines Nationalstolzes zu verstehen, auch wenn „Borussia“ die latinisierte Bezeichnung für Preußen ist.
Nachdem Kaplan Dewald die Mitglieder der Borussia in der Messe am Heiligen Abend der Spaltung der Dreifaltigkeitsgemeinde bezichtigte und sie aus der Sodalität ausschloss, verließen einige der Gründungsmitglieder den Verein wieder, die Borussia blieb aber bestehen. Der erste Vorsitzende wurde Heinrich Unger, der bereits Mitte 1910 von diesem Amt zurücktrat. Nach einem sechswöchigen Intermezzo von Franz Risse folgte ihm Franz Jacobi, der den Verein bis 1923 leitete.
Obwohl der Hauptgrund für die Gründung des Vereins die fehlende Erlaubnis des Kaplans zur Ausübung des Fußballsports war, besaß die Borussia zu Beginn nicht nur eine Fußball-, sondern auch eine Leichtathletikabteilung. Diese wurde bereits am 19. Juni 1910 in den Westdeutschen Spielverband (WSV) aufgenommen, am 3. Dezember folgte ihr die Fußballabteilung.
Der Aufnahme der Leichtathletikabteilung in den Verband kam dabei die Funktion eines „trojanischen Pferdes“ zu, da zu dieser Zeit aufgrund der großen Zahl an Gründungen von Fußballvereinen regelmäßig Aufnahmestopps seitens des WSV verhängt wurden. Den Tipp für dieses Vorgehen hatte die Führung des jungen Vereins laut Jacobi von Walter Sanß, dem damaligen Schrift- und späteren Geschäftsführer des DFB, erhalten, der zu jener Zeit auch den in den Anfangsjahren des Fußballs in Dortmund erfolgreicheren Lokalrivalen Dortmunder FC 95 leitete.
Das erste reguläre Spiel fand am 15. Januar 1911 gegen den VfB Dortmund statt und wurde mit 9:3 gewonnen. Die offizielle Spielkleidung bestand zu diesem Zeitpunkt aus einem blau-weiß gestreiften Hemd mit einer roten Schärpe und schwarzer Hose. Das erste Meisterschaftsspiel bestritt die Borussia am 10. September 1911 in Rauxel gegen die Spielabteilung des Turnerbundes Rauxel und gewann ebenfalls, diesmal mit 1:0.
Der Verein startete zur Saison 1911/12 in der C-Klasse, der dritten und untersten Spielklasse. Dort belegte man zum Saisonende den ersten Platz und stieg in die B-Klasse auf. Da der Aufnahmestopp des Westdeutschen Spielverbandes weiterhin Gültigkeit besaß, schlossen sich im Sommer 1912 die drei Dortmunder Vereine Rhenania, Britannia und Deutsche Flagge der Borussia an. Zugleich wechselte der BVB die Vereinsfarben, am 14. Februar 1913 billigte der WSV das zitronengelbe Hemd mit dem schwarzen „B“ als Spielkleidung der Borussia.
Die zweite Spielzeit endete mit dem dritten Platz, in der folgenden Saison 1913/14 stieg Borussia Dortmund erstmals in der Vereinsgeschichte in die damals höchste Spielklasse, die A-Klasse, auf. Da selbst auf westfälischer Ebene kein einheitliches Ligensystem vorhanden war und nur wenige Vereine zum Einzugsbereich der A-Klasse gehörten, konnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht von einer nationalen Bedeutung der Borussia sprechen.
Quelle: Matthias Kropp, Deutschlands große Fußballmannschaften, Teil 3: Borussia Dortmund. Agon Sportverlag, Kassel 1993.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Am 19. Dezember 1909, dem auch damals vierten Adventssonntag, trafen sich etwa 50 Mitglieder der Sodalität in einem Nebenraum des Wildschützes, um über die Gründung eines von der Kirche unabhängigen Sportvereins zu beraten.
Während des Treffens wurde heftig über die Trennung von der Gemeinde debattiert, eine Reihe der Teilnehmer verließ nach etwa einer Stunde die Sitzung und informierte Kaplan Dewald über die bevorstehende Gründung des Vereins. Dieser traf wenig später vor der Gaststätte ein, um die Sitzung aufzulösen, der Zutritt wurde ihm jedoch verweigert. Die 18 verbliebenen Personen – Franz und Paul Braun, Heinrich Cleve, Hans Debest, Paul Dziendzielle, Franz, Julius und Wilhelm Jacobi, Hans Kahn, Gustav Müller, Franz Risse, Fritz Schulte, Hans Siebold, August Tönnesmann, Heinrich und Robert Unger, Fritz Weber sowie Franz Wendt – gründeten noch am selben Abend den Verein.
Da die Gründung spontan und unvorbereitet ablief, gab es vor Beginn der Versammlung keine Namensvorschläge. Einer Anekdote zufolge wurde der Zusatz „Borussia“ gewählt, weil es sich um den Namen des im Wildschütz ausgeschenkten Bieres der Borussia-Brauerei handelte, die unweit des Borsigplatzes ihren Sitz hatte. Die Namenswahl ist daher wohl nicht als bewusster Ausdruck eines Nationalstolzes zu verstehen, auch wenn „Borussia“ die latinisierte Bezeichnung für Preußen ist.
Nachdem Kaplan Dewald die Mitglieder der Borussia in der Messe am Heiligen Abend der Spaltung der Dreifaltigkeitsgemeinde bezichtigte und sie aus der Sodalität ausschloss, verließen einige der Gründungsmitglieder den Verein wieder, die Borussia blieb aber bestehen. Der erste Vorsitzende wurde Heinrich Unger, der bereits Mitte 1910 von diesem Amt zurücktrat. Nach einem sechswöchigen Intermezzo von Franz Risse folgte ihm Franz Jacobi, der den Verein bis 1923 leitete.
Obwohl der Hauptgrund für die Gründung des Vereins die fehlende Erlaubnis des Kaplans zur Ausübung des Fußballsports war, besaß die Borussia zu Beginn nicht nur eine Fußball-, sondern auch eine Leichtathletikabteilung. Diese wurde bereits am 19. Juni 1910 in den Westdeutschen Spielverband (WSV) aufgenommen, am 3. Dezember folgte ihr die Fußballabteilung.
Der Aufnahme der Leichtathletikabteilung in den Verband kam dabei die Funktion eines „trojanischen Pferdes“ zu, da zu dieser Zeit aufgrund der großen Zahl an Gründungen von Fußballvereinen regelmäßig Aufnahmestopps seitens des WSV verhängt wurden. Den Tipp für dieses Vorgehen hatte die Führung des jungen Vereins laut Jacobi von Walter Sanß, dem damaligen Schrift- und späteren Geschäftsführer des DFB, erhalten, der zu jener Zeit auch den in den Anfangsjahren des Fußballs in Dortmund erfolgreicheren Lokalrivalen Dortmunder FC 95 leitete.
Das erste reguläre Spiel fand am 15. Januar 1911 gegen den VfB Dortmund statt und wurde mit 9:3 gewonnen. Die offizielle Spielkleidung bestand zu diesem Zeitpunkt aus einem blau-weiß gestreiften Hemd mit einer roten Schärpe und schwarzer Hose. Das erste Meisterschaftsspiel bestritt die Borussia am 10. September 1911 in Rauxel gegen die Spielabteilung des Turnerbundes Rauxel und gewann ebenfalls, diesmal mit 1:0.
Der Verein startete zur Saison 1911/12 in der C-Klasse, der dritten und untersten Spielklasse. Dort belegte man zum Saisonende den ersten Platz und stieg in die B-Klasse auf. Da der Aufnahmestopp des Westdeutschen Spielverbandes weiterhin Gültigkeit besaß, schlossen sich im Sommer 1912 die drei Dortmunder Vereine Rhenania, Britannia und Deutsche Flagge der Borussia an. Zugleich wechselte der BVB die Vereinsfarben, am 14. Februar 1913 billigte der WSV das zitronengelbe Hemd mit dem schwarzen „B“ als Spielkleidung der Borussia.
Die zweite Spielzeit endete mit dem dritten Platz, in der folgenden Saison 1913/14 stieg Borussia Dortmund erstmals in der Vereinsgeschichte in die damals höchste Spielklasse, die A-Klasse, auf. Da selbst auf westfälischer Ebene kein einheitliches Ligensystem vorhanden war und nur wenige Vereine zum Einzugsbereich der A-Klasse gehörten, konnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht von einer nationalen Bedeutung der Borussia sprechen.
Quelle: Matthias Kropp, Deutschlands große Fußballmannschaften, Teil 3: Borussia Dortmund. Agon Sportverlag, Kassel 1993.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
- yogi61
- Beiträge: 59494
- Registriert: Sonntag 1. Juni 2008, 11:00
- user title: Jugendbeauftragter
- Wohnort: Bierstadt von Welt
Re: Geschichte des Sports
Am 16. Dezember 1968 verunglückte Jürgen Moll und seine Ehefrau auf einer Urlaubsheimfahrt tödlich. Ihr Wagen war in der Nähe von Evendorf wegen Schneeglätte von der Autobahn abgekommen. Zugunsten seiner beiden verwaisten Töchter wurden am 14. April 1969 vor 21000 Zuschauern im Braunschweiger Eintracht-Stadion Benefizspiele ausgetragen: im ersten Match spielte die Weltmeister-Auswahl von 1954 (das erste Spiel dieser Mannschaft nach 1954) und im zweiten trat eine kombinierte Mannschaft von Eintracht Braunschweig/Hannover 96 gegen eine Bundesliga-Bestenauswahl an.
Jürgen Moll wäre einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten geworden,aber das Schicksal schlägt manchmal gnadenlos zu.
R.I.P.
Jürgen Moll wäre einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten geworden,aber das Schicksal schlägt manchmal gnadenlos zu.
R.I.P.
Two unique places, one heart
https://www.youtube.com/watch?v=Ca9jtQhnjek
https://www.youtube.com/watch?v=Ca9jtQhnjek
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, vielen Dank für die Erinnerung an Jürgen Moll. Er wurde 1967 Deutscher Meister mit Eintracht Braunschweig und spielte fünfmal im Europacup. Er war in der Meistersaison Stammspieler und zugleich einer der Führungsspieler der Mannschaft. Er war eine absolute Persönlichkeit.yogi61 » Sa 18. Dez 2010, 20:02 hat geschrieben:Am 16. Dezember 1968 verunglückte Jürgen Moll und seine Ehefrau auf einer Urlaubsheimfahrt tödlich. Ihr Wagen war in der Nähe von Evendorf wegen Schneeglätte von der Autobahn abgekommen. Zugunsten seiner beiden verwaisten Töchter wurden am 14. April 1969 vor 21000 Zuschauern im Braunschweiger Eintracht-Stadion Benefizspiele ausgetragen: im ersten Match spielte die Weltmeister-Auswahl von 1954 (das erste Spiel dieser Mannschaft nach 1954) und im zweiten trat eine kombinierte Mannschaft von Eintracht Braunschweig/Hannover 96 gegen eine Bundesliga-Bestenauswahl an.
Jürgen Moll wäre einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten geworden,aber das Schicksal schlägt manchmal gnadenlos zu.
R.I.P.
Viele Grüße aus FRankfurt am Main und einen besinnlichen 4. Advent
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, am 21. Dezember 1976 gewinnt der FC Bayern München im Rückspiel gegen Cruzeiro Belo Horizonte, vor 117.000 Zuschauern. (0:0, Hinspiel 2:0) als erster deutscher Fußballverein den Weltpokal.
Die Tore im Hinspiel erzielten 1:0 Gerd Müller (80.), 2:0 Hans-Josef Kapellmann (82.).
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Die Tore im Hinspiel erzielten 1:0 Gerd Müller (80.), 2:0 Hans-Josef Kapellmann (82.).
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, am 27. Dezember 1925 wird die Schattenbergschanze in Oberstdorf wird eingeweiht.
Die Skisprunganlage Schattenbergschanze liegt am östlichen Ortsrand von Oberstdorf unterhalb des namensgebenden Schattenbergs. Sie besteht aus einer HS137-Großschanze, einer HS100-Normalschanze, drei kleineren Mattenschanzen und einer Tribünenanlage (Erdinger Arena; früher Skisprungstadion am Schattenberg). Bekannt ist die Anlage als einer der Austragungsorte der Vierschanzentournee. Seit 1953 findet hier das Auftaktspringen der Sprungserie statt. Heimatverein ist der Skiclub Oberstdorf.
Eine erste Skisprungschanze (Schanze auf den Halden) gab es in Oberstdorf schon 1909. Der dort erreichte Schanzenrekord betrug 22 m (von Bruno Biehler). Das Gelände war für eine Schanze unter anderem wegen der starken Sonneneinstrahlung aber nicht optimal geeignet. Der kurze Anlauf und die damit begrenzten Weiten veranlassten den Skiclub Oberstdorf zusammen mit dem Sportausschuss des Verkehr- und Kurvereins nach einem Gelände für einen moderneren Schanzenneubau zu suchen. Der östlich von Oberstdorf gelegene Bereich am Fuß des Schattenbergs schien gut geeignet, weil der Ort meist im Schatten lag und das Grundstück zudem der Gemeinde gehörte.
Am 27. Dezember 1925 konnte die nach Plänen des Architekten Hans Schwendiger neu erbaute Schattenbergschanze eröffnet werden. Bereits 1930 wurde für die Deutschen Meisterschaften und 1936 für die Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen die Schanze vergrößert. Im Zweiten Weltkrieg verfiel die Schanze. Der letzte Wettkampf fand 1941 statt.
Die Wiedereröffnung erfolgte nach dem Wiederaufbau am 1. Januar 1946. Am 4. Januar 1953 fand auf der Schattenbergschanze zum ersten Mal ein Springen im Rahmen der Vierschanzentournee statt. Die Tournee mit dem Oberstdorfer Springen jeweils Ende Dezember ist heute die wichtigste Skisprungserie der Saison.
Die alte Anlage aus Holz, die zwar immer wieder angepasst und bis K 70 ausgebaut wurde, wurde bald den sich immer weiter entwickelnden Weiten der Springer nicht mehr gerecht. Um für die Austragung der Skiflug-Weltmeisterschaften 1973 auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze einen alternativen Ausweichort anbieten zu können, errichtete man eine K 115-Großschanze aus Stahlbeton und Leimholzbindern sowie die K 56-Schanze.
1987 wurden im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften die Spezial- und Kombinationswettbewerbe auf der Normal- und der Großschanze ausgetragen. Der Holzturm der Normalschanze, mittlerweile K 90, wurde durch einen Turm aus Stahlbeton und Leimholzbindern ersetzt. 1997 wurden zwei weitere kleine Schanzen (K 19 und K 30) für den Nachwuchs errichtet und die Großschanze erhielt einen Schrägaufzug. Bis Ende 2003 wurde die K 115-Schanze für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 durch den 16,6 Millionen Euro teuren Neubau einer K 120-Schanze (jetzt HS 137-Schanze) ersetzt. Sie soll höhere Weiten und eine größere Sicherheit ermöglichen. Alle Schanzen können seit 2004 mit Matten gesprungen werden. Auf der Normalschanze findet jeweils im Sommer ein FIS Continental Cup-Mattenspringen statt. Der Zuschauerbereich am Auslauf verstärkt durch die Errichtung weiterer Tribünen den Stadioncharakter. Das Fassungsvermögen wurde dadurch von 17.000 auf 27.000 Personen erhöht.
Seit dem 26. Dezember 2004 heißt das Skisprungstadion am Schattenberg offiziell Erdinger Arena. Die Brauerei Erdinger Weißbräu schloss einen Zehnjahresvertrag für das Namenssponsoring der Sportstätte. Diese Form des Sponsoring, die bisher nur von Fußballstadien oder großen Sporthallen bekannt ist, stellt eine Neuheit im internationalen Skisport dar. Der Vertrag soll eine Finanzierungslücke von 150.000 Euro decken, die der Betreibergesellschaft durch den Umbau der Anlage jährlich entsteht. Während den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 durfte das Stadion allerdings nicht Erdinger Arena heißen. Wegen der Interessenskollision mit anderen Sponsoren aus der Brauereibranche, die die Weltmeisterschaften und den Skiweltverband FIS finanziell unterstützten, wurde die Sportstätte während der Weltmeisterschaften als WM Skisprung Arena Oberstdorf bezeichnet.
Martin Schmitt war der erste Springer, dem es gelang, dreimal hintereinander auf der großen Schattenbergschanze zu gewinnen. Er entschied in den Jahren 1998–2000 das Auftaktspringen der Vierschanzentournee für sich. Auf der umgebauten Schattenbergschanze gelang bis jetzt nur Janne Ahonen dreimal hintereinander der Sieg.
Auch wenn kein Wettbewerb ausgetragen wird, sind Anlauf und Turm der HS 137-Schanze nachts beleuchtet.
Quellen: Schattenbergschanze bei Oberstdorf.de
Skiclub Oberstdorf 2010
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Die Skisprunganlage Schattenbergschanze liegt am östlichen Ortsrand von Oberstdorf unterhalb des namensgebenden Schattenbergs. Sie besteht aus einer HS137-Großschanze, einer HS100-Normalschanze, drei kleineren Mattenschanzen und einer Tribünenanlage (Erdinger Arena; früher Skisprungstadion am Schattenberg). Bekannt ist die Anlage als einer der Austragungsorte der Vierschanzentournee. Seit 1953 findet hier das Auftaktspringen der Sprungserie statt. Heimatverein ist der Skiclub Oberstdorf.
Eine erste Skisprungschanze (Schanze auf den Halden) gab es in Oberstdorf schon 1909. Der dort erreichte Schanzenrekord betrug 22 m (von Bruno Biehler). Das Gelände war für eine Schanze unter anderem wegen der starken Sonneneinstrahlung aber nicht optimal geeignet. Der kurze Anlauf und die damit begrenzten Weiten veranlassten den Skiclub Oberstdorf zusammen mit dem Sportausschuss des Verkehr- und Kurvereins nach einem Gelände für einen moderneren Schanzenneubau zu suchen. Der östlich von Oberstdorf gelegene Bereich am Fuß des Schattenbergs schien gut geeignet, weil der Ort meist im Schatten lag und das Grundstück zudem der Gemeinde gehörte.
Am 27. Dezember 1925 konnte die nach Plänen des Architekten Hans Schwendiger neu erbaute Schattenbergschanze eröffnet werden. Bereits 1930 wurde für die Deutschen Meisterschaften und 1936 für die Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen die Schanze vergrößert. Im Zweiten Weltkrieg verfiel die Schanze. Der letzte Wettkampf fand 1941 statt.
Die Wiedereröffnung erfolgte nach dem Wiederaufbau am 1. Januar 1946. Am 4. Januar 1953 fand auf der Schattenbergschanze zum ersten Mal ein Springen im Rahmen der Vierschanzentournee statt. Die Tournee mit dem Oberstdorfer Springen jeweils Ende Dezember ist heute die wichtigste Skisprungserie der Saison.
Die alte Anlage aus Holz, die zwar immer wieder angepasst und bis K 70 ausgebaut wurde, wurde bald den sich immer weiter entwickelnden Weiten der Springer nicht mehr gerecht. Um für die Austragung der Skiflug-Weltmeisterschaften 1973 auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze einen alternativen Ausweichort anbieten zu können, errichtete man eine K 115-Großschanze aus Stahlbeton und Leimholzbindern sowie die K 56-Schanze.
1987 wurden im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften die Spezial- und Kombinationswettbewerbe auf der Normal- und der Großschanze ausgetragen. Der Holzturm der Normalschanze, mittlerweile K 90, wurde durch einen Turm aus Stahlbeton und Leimholzbindern ersetzt. 1997 wurden zwei weitere kleine Schanzen (K 19 und K 30) für den Nachwuchs errichtet und die Großschanze erhielt einen Schrägaufzug. Bis Ende 2003 wurde die K 115-Schanze für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 durch den 16,6 Millionen Euro teuren Neubau einer K 120-Schanze (jetzt HS 137-Schanze) ersetzt. Sie soll höhere Weiten und eine größere Sicherheit ermöglichen. Alle Schanzen können seit 2004 mit Matten gesprungen werden. Auf der Normalschanze findet jeweils im Sommer ein FIS Continental Cup-Mattenspringen statt. Der Zuschauerbereich am Auslauf verstärkt durch die Errichtung weiterer Tribünen den Stadioncharakter. Das Fassungsvermögen wurde dadurch von 17.000 auf 27.000 Personen erhöht.
Seit dem 26. Dezember 2004 heißt das Skisprungstadion am Schattenberg offiziell Erdinger Arena. Die Brauerei Erdinger Weißbräu schloss einen Zehnjahresvertrag für das Namenssponsoring der Sportstätte. Diese Form des Sponsoring, die bisher nur von Fußballstadien oder großen Sporthallen bekannt ist, stellt eine Neuheit im internationalen Skisport dar. Der Vertrag soll eine Finanzierungslücke von 150.000 Euro decken, die der Betreibergesellschaft durch den Umbau der Anlage jährlich entsteht. Während den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 durfte das Stadion allerdings nicht Erdinger Arena heißen. Wegen der Interessenskollision mit anderen Sponsoren aus der Brauereibranche, die die Weltmeisterschaften und den Skiweltverband FIS finanziell unterstützten, wurde die Sportstätte während der Weltmeisterschaften als WM Skisprung Arena Oberstdorf bezeichnet.
Martin Schmitt war der erste Springer, dem es gelang, dreimal hintereinander auf der großen Schattenbergschanze zu gewinnen. Er entschied in den Jahren 1998–2000 das Auftaktspringen der Vierschanzentournee für sich. Auf der umgebauten Schattenbergschanze gelang bis jetzt nur Janne Ahonen dreimal hintereinander der Sieg.
Auch wenn kein Wettbewerb ausgetragen wird, sind Anlauf und Turm der HS 137-Schanze nachts beleuchtet.
Quellen: Schattenbergschanze bei Oberstdorf.de
Skiclub Oberstdorf 2010
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, am 14. Januar 1897 verteidigt der Deutsche Emanuel Lasker seinen Weltmeistertitel im Schach durch einen deutlichen Sieg (10:2 Siege, dazu 5 Remis) gegen seinen Vorgänger, den Österreicher Wilhelm Steinitz.
Emanuel Lasker (* 24. Dezember 1868 in Berlinchen, Neumark; † 11. Januar 1941 in New York) war ein deutscher Schachspieler, Mathematiker und Philosoph. Er war der zweite offizielle und zugleich der bislang einzige deutsche Schachweltmeister. Er behauptete diese Position über einen Zeitraum von 27 Jahren (1894 bis 1921) und damit länger als jeder andere Träger dieses Titels.
Vom 15. März bis zum 26. Mai 1894 fand das Match statt. Mit 10 Siegen bei 5 Niederlagen und 4 Unentschieden wurde Lasker überlegen der zweite offizielle Schachweltmeister. Er spielte in dem Match nicht besonders spektakulär, nutzte aber die Schwächen seines Gegners, der den Zenit seiner Karriere bereits überschritten hatte, sehr effizient aus. In seinem ersten Turnier als Weltmeister in Hastings 1895 musste er allerdings dem Amerikaner Harry Nelson Pillsbury den Sieg überlassen. Im selben Jahr veröffentlichte er sein erstes Schachbuch Common sense in chess (deutsch: Gesunder Menschenverstand im Schach), das auf Vorträgen beruhte, die er in englischen Schachclubs gehalten hatte.
Lasker lebte bis 1896 überwiegend in den USA. Er gab Steinitz 1896 bis zum 14. Januar 1897 einen Revanchewettkampf in Moskau, den er noch deutlicher mit 10 Siegen, 2 Niederlagen und 5 Unentschieden gewann. Dann zog er sich bis 1899 vom Schach zurück, um sein Studium in Heidelberg und Berlin fortzusetzen. 1900 promovierte er an der Universität Erlangen mit seiner Dissertation Über Reihen auf der Convergenzgrenze (veröffentlicht 1901) zum Dr. phil. (Mathematik).
Lasker gewann 1923 in Mährisch-Ostrau und 1924 in New York zwei sehr stark besetzte Turniere. Das New Yorker Turnier gilt als eines der bedeutendsten überhaupt in der Geschichte des Schachs. Dort spielte Emanuel Lasker auch die einzigen beiden Turnierpartien gegen seinen Namensvetter Edward Lasker. In einer dieser Partien hielt Emanuel Lasker ein Endspiel mit Springer gegen Turm und Bauer remis, was als eine der größten Defensivleistungen seiner Karriere gilt.
In dem doppelrundigen Turnier schlug Weltmeister Capablanca den Exweltmeister mit 1½:½, doch Emanuel Lasker gewann das Turnier im Alter von 55 Jahren, und zwar mit 16 Punkten aus 20 Partien mit 1½ Punkten Vorsprung vor Capablanca mit 14½ Punkten und mit 4 Punkten Vorsprung auf den künftigen Weltmeister Aljechin. 1925 überholte er Capablanca in Moskau, wo er Zweiter hinter Efim Bogoljubow wurde, nochmals um einen halben Punkt. Das Moskauer Turnier sollte nun für lange Zeit das Ende von Laskers Schachkarriere bedeuten. Im selben Jahr erschien sein Lehrbuch des Schachspiels, in dem er unter anderem die Verdienste seines Vorgängers Steinitz um die Erforschung des Positionsspiels würdigt.
Das Buch enthält zahlreiche philosophische Exkurse und zählt heute zu den Klassikern der Schachliteratur. Außerdem veröffentlichte er zusammen mit seinem Bruder Bertold ein von seiner machologischen Philosophie inspiriertes expressionistisches Drama, Vom Menschen die Geschichte, dem allerdings kein Bühnenerfolg beschieden war. Er widmete sich seit 1926 vermehrt dem Go-Spiel, das er bereits seit 1910 intensiv pflegte. Er galt bald als ein Konkurrent des besten damaligen Go-Spielers Deutschlands, des Berliners Felix Dueball, den er 1930 in einer Turnierpartie, deren Notation erhalten ist, besiegen konnte.
Neben Go wurde auch das Bridge-Spiel ein Betätigungsfeld für Lasker. Außerdem galt er als guter Poker-Spieler. 1927 gründete er in Berlin eine Schule für Verstandesspiele. In dieser Zeit erfand er auch das Brettspiel Laska, eine Variante des Damespiels, und die Lasker-Mühle. 1929 erschien sein Buch Das verständige Kartenspiel, 1931 Das Bridgespiel, Das Skatspiel und Brettspiele der Völker. 1932 verkündete Lasker seinen Abschied vom Schach und plante, sich gänzlich dem Bridge zu widmen.
Ludwig Rellstab (Hrsg.), Weltgeschichte des Schachs. Lieferung 11: Dr. Emanuel Lasker 573 Partien, Wildhagen, Hamburg 1958
Ken Whyld (Hrsg.): The Collected Games of Emanuel Lasker. Czech Republic/Nottingham 1998.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Emanuel Lasker (* 24. Dezember 1868 in Berlinchen, Neumark; † 11. Januar 1941 in New York) war ein deutscher Schachspieler, Mathematiker und Philosoph. Er war der zweite offizielle und zugleich der bislang einzige deutsche Schachweltmeister. Er behauptete diese Position über einen Zeitraum von 27 Jahren (1894 bis 1921) und damit länger als jeder andere Träger dieses Titels.
Vom 15. März bis zum 26. Mai 1894 fand das Match statt. Mit 10 Siegen bei 5 Niederlagen und 4 Unentschieden wurde Lasker überlegen der zweite offizielle Schachweltmeister. Er spielte in dem Match nicht besonders spektakulär, nutzte aber die Schwächen seines Gegners, der den Zenit seiner Karriere bereits überschritten hatte, sehr effizient aus. In seinem ersten Turnier als Weltmeister in Hastings 1895 musste er allerdings dem Amerikaner Harry Nelson Pillsbury den Sieg überlassen. Im selben Jahr veröffentlichte er sein erstes Schachbuch Common sense in chess (deutsch: Gesunder Menschenverstand im Schach), das auf Vorträgen beruhte, die er in englischen Schachclubs gehalten hatte.
Lasker lebte bis 1896 überwiegend in den USA. Er gab Steinitz 1896 bis zum 14. Januar 1897 einen Revanchewettkampf in Moskau, den er noch deutlicher mit 10 Siegen, 2 Niederlagen und 5 Unentschieden gewann. Dann zog er sich bis 1899 vom Schach zurück, um sein Studium in Heidelberg und Berlin fortzusetzen. 1900 promovierte er an der Universität Erlangen mit seiner Dissertation Über Reihen auf der Convergenzgrenze (veröffentlicht 1901) zum Dr. phil. (Mathematik).
Lasker gewann 1923 in Mährisch-Ostrau und 1924 in New York zwei sehr stark besetzte Turniere. Das New Yorker Turnier gilt als eines der bedeutendsten überhaupt in der Geschichte des Schachs. Dort spielte Emanuel Lasker auch die einzigen beiden Turnierpartien gegen seinen Namensvetter Edward Lasker. In einer dieser Partien hielt Emanuel Lasker ein Endspiel mit Springer gegen Turm und Bauer remis, was als eine der größten Defensivleistungen seiner Karriere gilt.
In dem doppelrundigen Turnier schlug Weltmeister Capablanca den Exweltmeister mit 1½:½, doch Emanuel Lasker gewann das Turnier im Alter von 55 Jahren, und zwar mit 16 Punkten aus 20 Partien mit 1½ Punkten Vorsprung vor Capablanca mit 14½ Punkten und mit 4 Punkten Vorsprung auf den künftigen Weltmeister Aljechin. 1925 überholte er Capablanca in Moskau, wo er Zweiter hinter Efim Bogoljubow wurde, nochmals um einen halben Punkt. Das Moskauer Turnier sollte nun für lange Zeit das Ende von Laskers Schachkarriere bedeuten. Im selben Jahr erschien sein Lehrbuch des Schachspiels, in dem er unter anderem die Verdienste seines Vorgängers Steinitz um die Erforschung des Positionsspiels würdigt.
Das Buch enthält zahlreiche philosophische Exkurse und zählt heute zu den Klassikern der Schachliteratur. Außerdem veröffentlichte er zusammen mit seinem Bruder Bertold ein von seiner machologischen Philosophie inspiriertes expressionistisches Drama, Vom Menschen die Geschichte, dem allerdings kein Bühnenerfolg beschieden war. Er widmete sich seit 1926 vermehrt dem Go-Spiel, das er bereits seit 1910 intensiv pflegte. Er galt bald als ein Konkurrent des besten damaligen Go-Spielers Deutschlands, des Berliners Felix Dueball, den er 1930 in einer Turnierpartie, deren Notation erhalten ist, besiegen konnte.
Neben Go wurde auch das Bridge-Spiel ein Betätigungsfeld für Lasker. Außerdem galt er als guter Poker-Spieler. 1927 gründete er in Berlin eine Schule für Verstandesspiele. In dieser Zeit erfand er auch das Brettspiel Laska, eine Variante des Damespiels, und die Lasker-Mühle. 1929 erschien sein Buch Das verständige Kartenspiel, 1931 Das Bridgespiel, Das Skatspiel und Brettspiele der Völker. 1932 verkündete Lasker seinen Abschied vom Schach und plante, sich gänzlich dem Bridge zu widmen.
Ludwig Rellstab (Hrsg.), Weltgeschichte des Schachs. Lieferung 11: Dr. Emanuel Lasker 573 Partien, Wildhagen, Hamburg 1958
Ken Whyld (Hrsg.): The Collected Games of Emanuel Lasker. Czech Republic/Nottingham 1998.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hallo, am 28. Januar 1900 wurde in Leipzig der Deutsche Fussballbund gegründet.
Im Deutschen Reich hatte Sport im 19. Jahrhundert nur eine untergeordnete Bedeutung. Unter den aus England übernommenen Mannschaftssportarten dominierte zunächst Rugby Football von 1875 bis Mitte der 1880er Jahre. Ende der 1880er Jahre wurde neben Rugby auch Association Fußball gespielt.
Wie in ganz Deutschland vollzog sich auch in Berlin die Entwicklung erst sehr schleppend. Im Winter 1881/82 trugen, wie auch zum gleichen Zeitpunkt in Hamburg, in der Stadt anwesende Engländer das erste Association Fußballspiel aus. Dennoch geschah bis 1888 wenig. 1883 spielten Engländer und Deutsche gelegentlich auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, im Hoppegarten, in Pankow (Schönholz) und in Nieder-Schöneweide. Erst zum Ende der 1880er Jahre setzte eine rasante Entwicklung durch die Gründung einer Vielzahl von Fußballklubs ein. Am 15. April 1888 wurde mit dem BFC Germania 1888 der älteste deutsche Fußballverein gegründet.
Die neu gegründeten Vereine organisierten sich in vielen verschiedenen Verbänden. Vor allem in Berlin gab es eine Vielzahl an parallel existierenden Fußballverbänden. Nach Berlin folgte der Süden (Südwesten) 1893 mit einem eigenen Verband, die Süd-Westdeutsche Fußball-Union, die aber auf Grund interner Streitigkeiten und der geringen Anzahl von Klubs im Süden nur zwei Jahre lang existierte. Danach folgte Hamburg/Altona mit dem Hamburg-Altonaer Fußball-Bund und Leipzig mit dem Verband Leipziger Ballspiel-Vereine und mit den Jahren weitere lokale und regionale Verbände. Dazu gehörten 1897 der Verband Süddeutscher Fußball-Vereine und ein Jahr später der Rheinische Spiel-Verband im Westen sowie der Deutsche Fußball-Bund im Jahre 1900 als Dachverband.
Am 28. Januar 1900 trafen sich in der Gaststätte „Zum Mariengarten“ in Leipzig 36 Vertreter von 86 Vereinen zur Gründungsversammlung des DFB. Ferdinand Hueppe wurde anschließend zum ersten Präsidenten des DFB gewählt. Eine Plakette am Gründungsgebäude in der heutigen Büttnerstraße unweit des Hauptbahnhofes erinnert Passanten an das historische Ereignis.
Trotz aller Treueschwüre der linientreuen Funktionäre wurde dem DFB aufgrund eines Erlass des Reichssportkommissars vom Juni 1933 die Existenzgrundlage entzogen, als 15 neue Fachverbände den alten Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen ersetzen und ein Fachverband Fußball (Fachamt Fußball) gegründet wurde. Nur diese Verbände hatten noch das Recht Meisterschaften durchzuführen. Die Regional- oder Landesverbände (diese bildeten den DFB) verschwanden; an deren Stelle traten analog zu den NSDAP-Gauen 16 Gaue, mit je zehn Gauklassemannschaften.
Angesichts dieser Situation fand am 9. Juli 1933 in Berlin ein außerordentlicher Bundestag des DFB statt, der ganze 28 Minuten dauerte. Bei diesem wurde Linnemann einstimmig ermächtigt, alle personellen und sachlichen Maßnahmen einzuleiten, um den DFB in das Programm des Reichssportkommissars einzugliedern und damit eine entscheidende Umwandlung des DFB vorzunehmen. Da sich Linnemann an die Anweisungen Tschammers hielt und diese widerstandslos umsetzte, durften die gestandenen Vereine ihre Namen behalten (nur wenige zum Beispiel SS Straßburg benannten oder gründeten sich neu), und seine alten Mitstreiter blieben im Amt. Er schaffte es auch, dass im neuen Fachverband Fußball, bis auf den Chef des Gau 3 (Berlin) Prof. Otto Glöckler, kein Neuling aus der Partei in Führungspositionen gelangte.
Auch wenn Linnemann und Nerz mit der Umgestaltung des DFB schnell fortschritten, war damit doch die eigentliche Grundlage der Existenz entscheidend entzogen. Selbst die erfolgreiche Einführung des Tschammer-Pokals als deutschen Vereinspokal, dieser kam beim Fußballvolk gut an, und im Hinblick auf den Höhepunkt Olympia 1936 konnte darüber nicht hinwegtäuschen.
Als Debakel erschien dann auch die 0:2-Niederlage gegen Norwegen, bei den Olympischen Spiele in Berlin, bei dem Adolf Hitler sein erstes und letztes Länderspiel erlebte, und somit eine wichtige, bislang vorhandene, Unterstützung fehlte und letztlich auch zur Auswechselung von Nerz gegen Herberger führte. Spätestens 1938 hatten die Nationalsozialisten ihr Ziel der Zerschlagung des Arbeitersports, und damit eine der wichtigsten Stützen des deutschen Sports und folglich auch des DFB, erreicht.
Nach den Ereignissen der Olympiade 1936 und der WM 1938 in Frankreich, wandte sich die NS-Führung vom Fußball weitgehend ab, und dies auch, obwohl die Stellung im Weltfußball durchaus weiterhin beachtlich war. Immerhin stellte der DFB mit Ivo Schricker den Generalsekretär der FIFA und vier Deutsche Spieler (Jakob, Kitzinger, Goldbrunner und Lehner) spielten bei einem FIFA-Freundschaftsspiel in Amsterdam, und zwei Spieler (Albin Kitzinger und Anderl Kupfer) standen gegen eine Kontinentalauswahl in der FIFA-Auswahl.
Auf der ersten Sitzung des Exekutivkomitees nach Ende des Zweiten Weltkrieges am 10. bis 12. November 1945 in Zürich beschloss die FIFA die Sportbeziehungen im Sinne der FIFA-Statuten zu Deutschland (wie auch zu Japan) und damit zur Nationalmannschaft und allen Verbänden abzubrechen, und verfügte gleichzeitig ein Verbot an alle Mitgliedsverbände, Sportbeziehungen zu Deutschland zu unterhalten. Eine Teilnahme des (ohnehin aufgelösten) DFB und seiner Verbände an internationalen Wettbewerben war daher in den Nachkriegsjahren nicht mehr möglich.
Dies änderte sich erst wieder, als der englische Fußballverband (The FA) 1949 bei der FIFA eine Wiederzulassung Deutschlands zum internationalen Spielverkehr beantragte. Die FIFA hob daraufhin das Spielverbot gegen alle deutschen Mannschaften auf, verlangte aber am 7. Mai 1949, dass vor jedem internationalen Spiel die jeweilige Militärregierung, in deren Besatzungszone ein internationales Spiel ausgetragen werden soll, ihre Zustimmung erteilt.
Die offizielle und rechtsverbindliche Wiedergründung des DFB nach dem Krieg wurde am 21. Januar 1950 bei einer Arbeitstagung aller westdeutschen Verbände (außer Saarland) in Stuttgart beschlossen. Für die ostdeutschen Gebiete wurde im Juli 1950 der Deutsche Fußball-Verband gegründet. Die endgültige Wiederaufnahme des DFB in die FIFA wurde am 22. September 1950 durch das Exekutivkomitee bei dessen Sitzung in Brüssel beschlossen, nachdem dieses bereits beim FIFA-Kongress am 22. Juni des Jahres durch den Schweizerischen Fussballverband (SFV) beantragt hatte. Der DFB und seine Verbände waren ab diesem Zeitpunkt wieder ohne Einschränkung international teilnahmeberechtigt.
1962 – wenige Wochen nachdem die bundesdeutsche Nationalmannschaft bei der WM in Chile im Viertelfinale ausgeschieden war – schlug der spätere DFB-Präsident Hermann Neuberger dann erneut die Schaffung einer einheitlichen höchsten Spielklasse vor. Am 28. Juli 1962 beschloss der DFB-Bundestag in Dortmund schließlich die Einführung der Bundesliga zur Saison 1963/64.
Seit diesem Zeitpunkt wird die bundesdeutsche Fußballmeisterschaft im Ligasystem ausgespielt (bis 1991 auf Westdeutschland beschränkt). Der bundesdeutsche Meister wurde dann in den 30, später 34 Spieltagen der 1. Bundesliga ausgespielt. Die 1. Bundesliga besteht seit 1965 aus 18 Mannschaften, vorher waren es 16, 1991/92 gab es im Zuge der Wiedervereinigung vorübergehend eine Saison mit 20 Vereinen.
Entwicklung seit den 1970ern [Bearbeiten]
Im Jahr 1974 veranstaltete der DFB in der Bundesrepublik zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und wurde im eigenen Land Fußball-Weltmeister. Als nächste große Veranstaltung folgte 1988 die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Am 21. November 1990 trat der einen Tag vorher gebildete Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) auf einem außerordentlichen Bundestag des DFB in Leipzig diesem bei, und vereinigte damit erstmals seit 1945 wieder alle deutschen Landesverbände in einem Bund.
1990 wird die Fa. Mercedes-Benz, die den DFB bereits seit 1972 unterstützt, Generalsponsor des DFB. Die Auswahlmannschaften tragen seitdem den Mercedes-Stern auf den Trainingsjacken. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich mehrmals verlängert, zuletzt im Juni 2006 bis 2012.
Der DFB zählt zu den erfolgreichsten Fussballverbänden der Welt:
Fußball-Weltmeisterschaften der Männer:
Sieg: 1954, 1974, 1990
Platz 2: 1966, 1982, 1986, 2002
Platz 3: 1934, 1970, 2006, 2010
Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen:
Sieg 2003, 2007 (Rekord, zusammen mit den USA)
Platz 2: 1995.
Fußball-Europameisterschaften der Männer:
Sieg: 1972, 1980, 1996 (Rekord)
Platz 2: 1976, 1992, 2008
Halbfinalist (kein Spiel um Platz 3): 1988
Fußball-Europameisterschaft der Frauen:
Sieg: 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 (Rekord)
Halbfinale: 1993.
Literatur: Deutscher Fußball Bund (Hrsg.): 100 Jahre DFB: Geschichte des Deutschen Fußball Bundes. SVB Sportverlag Berlin, Berlin 1999.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Im Deutschen Reich hatte Sport im 19. Jahrhundert nur eine untergeordnete Bedeutung. Unter den aus England übernommenen Mannschaftssportarten dominierte zunächst Rugby Football von 1875 bis Mitte der 1880er Jahre. Ende der 1880er Jahre wurde neben Rugby auch Association Fußball gespielt.
Wie in ganz Deutschland vollzog sich auch in Berlin die Entwicklung erst sehr schleppend. Im Winter 1881/82 trugen, wie auch zum gleichen Zeitpunkt in Hamburg, in der Stadt anwesende Engländer das erste Association Fußballspiel aus. Dennoch geschah bis 1888 wenig. 1883 spielten Engländer und Deutsche gelegentlich auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, im Hoppegarten, in Pankow (Schönholz) und in Nieder-Schöneweide. Erst zum Ende der 1880er Jahre setzte eine rasante Entwicklung durch die Gründung einer Vielzahl von Fußballklubs ein. Am 15. April 1888 wurde mit dem BFC Germania 1888 der älteste deutsche Fußballverein gegründet.
Die neu gegründeten Vereine organisierten sich in vielen verschiedenen Verbänden. Vor allem in Berlin gab es eine Vielzahl an parallel existierenden Fußballverbänden. Nach Berlin folgte der Süden (Südwesten) 1893 mit einem eigenen Verband, die Süd-Westdeutsche Fußball-Union, die aber auf Grund interner Streitigkeiten und der geringen Anzahl von Klubs im Süden nur zwei Jahre lang existierte. Danach folgte Hamburg/Altona mit dem Hamburg-Altonaer Fußball-Bund und Leipzig mit dem Verband Leipziger Ballspiel-Vereine und mit den Jahren weitere lokale und regionale Verbände. Dazu gehörten 1897 der Verband Süddeutscher Fußball-Vereine und ein Jahr später der Rheinische Spiel-Verband im Westen sowie der Deutsche Fußball-Bund im Jahre 1900 als Dachverband.
Am 28. Januar 1900 trafen sich in der Gaststätte „Zum Mariengarten“ in Leipzig 36 Vertreter von 86 Vereinen zur Gründungsversammlung des DFB. Ferdinand Hueppe wurde anschließend zum ersten Präsidenten des DFB gewählt. Eine Plakette am Gründungsgebäude in der heutigen Büttnerstraße unweit des Hauptbahnhofes erinnert Passanten an das historische Ereignis.
Trotz aller Treueschwüre der linientreuen Funktionäre wurde dem DFB aufgrund eines Erlass des Reichssportkommissars vom Juni 1933 die Existenzgrundlage entzogen, als 15 neue Fachverbände den alten Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen ersetzen und ein Fachverband Fußball (Fachamt Fußball) gegründet wurde. Nur diese Verbände hatten noch das Recht Meisterschaften durchzuführen. Die Regional- oder Landesverbände (diese bildeten den DFB) verschwanden; an deren Stelle traten analog zu den NSDAP-Gauen 16 Gaue, mit je zehn Gauklassemannschaften.
Angesichts dieser Situation fand am 9. Juli 1933 in Berlin ein außerordentlicher Bundestag des DFB statt, der ganze 28 Minuten dauerte. Bei diesem wurde Linnemann einstimmig ermächtigt, alle personellen und sachlichen Maßnahmen einzuleiten, um den DFB in das Programm des Reichssportkommissars einzugliedern und damit eine entscheidende Umwandlung des DFB vorzunehmen. Da sich Linnemann an die Anweisungen Tschammers hielt und diese widerstandslos umsetzte, durften die gestandenen Vereine ihre Namen behalten (nur wenige zum Beispiel SS Straßburg benannten oder gründeten sich neu), und seine alten Mitstreiter blieben im Amt. Er schaffte es auch, dass im neuen Fachverband Fußball, bis auf den Chef des Gau 3 (Berlin) Prof. Otto Glöckler, kein Neuling aus der Partei in Führungspositionen gelangte.
Auch wenn Linnemann und Nerz mit der Umgestaltung des DFB schnell fortschritten, war damit doch die eigentliche Grundlage der Existenz entscheidend entzogen. Selbst die erfolgreiche Einführung des Tschammer-Pokals als deutschen Vereinspokal, dieser kam beim Fußballvolk gut an, und im Hinblick auf den Höhepunkt Olympia 1936 konnte darüber nicht hinwegtäuschen.
Als Debakel erschien dann auch die 0:2-Niederlage gegen Norwegen, bei den Olympischen Spiele in Berlin, bei dem Adolf Hitler sein erstes und letztes Länderspiel erlebte, und somit eine wichtige, bislang vorhandene, Unterstützung fehlte und letztlich auch zur Auswechselung von Nerz gegen Herberger führte. Spätestens 1938 hatten die Nationalsozialisten ihr Ziel der Zerschlagung des Arbeitersports, und damit eine der wichtigsten Stützen des deutschen Sports und folglich auch des DFB, erreicht.
Nach den Ereignissen der Olympiade 1936 und der WM 1938 in Frankreich, wandte sich die NS-Führung vom Fußball weitgehend ab, und dies auch, obwohl die Stellung im Weltfußball durchaus weiterhin beachtlich war. Immerhin stellte der DFB mit Ivo Schricker den Generalsekretär der FIFA und vier Deutsche Spieler (Jakob, Kitzinger, Goldbrunner und Lehner) spielten bei einem FIFA-Freundschaftsspiel in Amsterdam, und zwei Spieler (Albin Kitzinger und Anderl Kupfer) standen gegen eine Kontinentalauswahl in der FIFA-Auswahl.
Auf der ersten Sitzung des Exekutivkomitees nach Ende des Zweiten Weltkrieges am 10. bis 12. November 1945 in Zürich beschloss die FIFA die Sportbeziehungen im Sinne der FIFA-Statuten zu Deutschland (wie auch zu Japan) und damit zur Nationalmannschaft und allen Verbänden abzubrechen, und verfügte gleichzeitig ein Verbot an alle Mitgliedsverbände, Sportbeziehungen zu Deutschland zu unterhalten. Eine Teilnahme des (ohnehin aufgelösten) DFB und seiner Verbände an internationalen Wettbewerben war daher in den Nachkriegsjahren nicht mehr möglich.
Dies änderte sich erst wieder, als der englische Fußballverband (The FA) 1949 bei der FIFA eine Wiederzulassung Deutschlands zum internationalen Spielverkehr beantragte. Die FIFA hob daraufhin das Spielverbot gegen alle deutschen Mannschaften auf, verlangte aber am 7. Mai 1949, dass vor jedem internationalen Spiel die jeweilige Militärregierung, in deren Besatzungszone ein internationales Spiel ausgetragen werden soll, ihre Zustimmung erteilt.
Die offizielle und rechtsverbindliche Wiedergründung des DFB nach dem Krieg wurde am 21. Januar 1950 bei einer Arbeitstagung aller westdeutschen Verbände (außer Saarland) in Stuttgart beschlossen. Für die ostdeutschen Gebiete wurde im Juli 1950 der Deutsche Fußball-Verband gegründet. Die endgültige Wiederaufnahme des DFB in die FIFA wurde am 22. September 1950 durch das Exekutivkomitee bei dessen Sitzung in Brüssel beschlossen, nachdem dieses bereits beim FIFA-Kongress am 22. Juni des Jahres durch den Schweizerischen Fussballverband (SFV) beantragt hatte. Der DFB und seine Verbände waren ab diesem Zeitpunkt wieder ohne Einschränkung international teilnahmeberechtigt.
1962 – wenige Wochen nachdem die bundesdeutsche Nationalmannschaft bei der WM in Chile im Viertelfinale ausgeschieden war – schlug der spätere DFB-Präsident Hermann Neuberger dann erneut die Schaffung einer einheitlichen höchsten Spielklasse vor. Am 28. Juli 1962 beschloss der DFB-Bundestag in Dortmund schließlich die Einführung der Bundesliga zur Saison 1963/64.
Seit diesem Zeitpunkt wird die bundesdeutsche Fußballmeisterschaft im Ligasystem ausgespielt (bis 1991 auf Westdeutschland beschränkt). Der bundesdeutsche Meister wurde dann in den 30, später 34 Spieltagen der 1. Bundesliga ausgespielt. Die 1. Bundesliga besteht seit 1965 aus 18 Mannschaften, vorher waren es 16, 1991/92 gab es im Zuge der Wiedervereinigung vorübergehend eine Saison mit 20 Vereinen.
Entwicklung seit den 1970ern [Bearbeiten]
Im Jahr 1974 veranstaltete der DFB in der Bundesrepublik zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und wurde im eigenen Land Fußball-Weltmeister. Als nächste große Veranstaltung folgte 1988 die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Am 21. November 1990 trat der einen Tag vorher gebildete Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) auf einem außerordentlichen Bundestag des DFB in Leipzig diesem bei, und vereinigte damit erstmals seit 1945 wieder alle deutschen Landesverbände in einem Bund.
1990 wird die Fa. Mercedes-Benz, die den DFB bereits seit 1972 unterstützt, Generalsponsor des DFB. Die Auswahlmannschaften tragen seitdem den Mercedes-Stern auf den Trainingsjacken. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich mehrmals verlängert, zuletzt im Juni 2006 bis 2012.
Der DFB zählt zu den erfolgreichsten Fussballverbänden der Welt:
Fußball-Weltmeisterschaften der Männer:
Sieg: 1954, 1974, 1990
Platz 2: 1966, 1982, 1986, 2002
Platz 3: 1934, 1970, 2006, 2010
Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen:
Sieg 2003, 2007 (Rekord, zusammen mit den USA)
Platz 2: 1995.
Fußball-Europameisterschaften der Männer:
Sieg: 1972, 1980, 1996 (Rekord)
Platz 2: 1976, 1992, 2008
Halbfinalist (kein Spiel um Platz 3): 1988
Fußball-Europameisterschaft der Frauen:
Sieg: 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 (Rekord)
Halbfinale: 1993.
Literatur: Deutscher Fußball Bund (Hrsg.): 100 Jahre DFB: Geschichte des Deutschen Fußball Bundes. SVB Sportverlag Berlin, Berlin 1999.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS
Re: Geschichte des Sports
Moin !
Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieses thread, denn historische Abrisse werden vermengt mit irgendwelchen Ereignissen, über deren Bedeutung man streiten kann.
Unter dem recht anspruchsvoll anmutenden Titel "Geschichte des Sports" stelle ich mir Anderes vor...
Lebensinhalt Nr. 2 (nach Rockmusik) ist, inzwischen: war für mich der Leistungssport (Schwimmen, Handball, Volleyball); aber auch sporttheoretisch war ich immer interessiert.
Meine Abhandlungen (vor Jahrzehnten) wurden sowohl vom DSB als auch vom Deutschen Institut für Sportwissenschaft, Köln-Lövenich, veröffentlicht. U.a. geht es um "Die geschichtliche Entwicklung des Breitensports in Deutschland", um "Sport oder Kommerz ? Vom Trimm dich-Pfad über Aerobic bis zum Fitness-Studio" und um die "Kritische Analyse der Olympischen Spiele von der Antike bis zur Neuzeit"...
So wenig vorerst.
johnpaul
Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieses thread, denn historische Abrisse werden vermengt mit irgendwelchen Ereignissen, über deren Bedeutung man streiten kann.
Unter dem recht anspruchsvoll anmutenden Titel "Geschichte des Sports" stelle ich mir Anderes vor...
Lebensinhalt Nr. 2 (nach Rockmusik) ist, inzwischen: war für mich der Leistungssport (Schwimmen, Handball, Volleyball); aber auch sporttheoretisch war ich immer interessiert.
Meine Abhandlungen (vor Jahrzehnten) wurden sowohl vom DSB als auch vom Deutschen Institut für Sportwissenschaft, Köln-Lövenich, veröffentlicht. U.a. geht es um "Die geschichtliche Entwicklung des Breitensports in Deutschland", um "Sport oder Kommerz ? Vom Trimm dich-Pfad über Aerobic bis zum Fitness-Studio" und um die "Kritische Analyse der Olympischen Spiele von der Antike bis zur Neuzeit"...
So wenig vorerst.
johnpaul
"Nichts ist schwieriger im Leben,und nichts erfordert mehr Charakter,
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stehen und laut zu sagen: 'NEIN !' "
(Kurt Tucholsky)
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stehen und laut zu sagen: 'NEIN !' "
(Kurt Tucholsky)
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Hier geht es um Geschichte - Sportgeschichte! Geschichte im allgemeinen Sinn bezeichnet alles, was geschehen ist. Im engeren Sinne ist Geschichte die Entwicklung der Menschheit, weshalb auch von Menschheitsgeschichte gesprochen wird (im Unterschied etwa zur Naturgeschichte).johnpaul » Mi 2. Mär 2011, 18:26 hat geschrieben:Moin !
Ich verstehe nicht ganz den Sinn dieses thread, denn historische Abrisse werden vermengt mit irgendwelchen Ereignissen, über deren Bedeutung man streiten kann.
Unter dem recht anspruchsvoll anmutenden Titel "Geschichte des Sports" stelle ich mir Anderes vor...
Lebensinhalt Nr. 2 (nach Rockmusik) ist, inzwischen: war für mich der Leistungssport (Schwimmen, Handball, Volleyball); aber auch sporttheoretisch war ich immer interessiert.
Meine Abhandlungen (vor Jahrzehnten) wurden sowohl vom DSB als auch vom Deutschen Institut für Sportwissenschaft, Köln-Lövenich, veröffentlicht. U.a. geht es um "Die geschichtliche Entwicklung des Breitensports in Deutschland", um "Sport oder Kommerz ? Vom Trimm dich-Pfad über Aerobic bis zum Fitness-Studio" und um die "Kritische Analyse der Olympischen Spiele von der Antike bis zur Neuzeit"...
So wenig vorerst.
johnpaul
Hier sollen in loser Folge Ereignisse aus der Geschichte des Sports ihren Platz finden.
Das es Ereignisse gibt, "über deren Bedeutung man streiten kann" - wie Sie sagen, liegt im Sinne der Geschichte.
Das hat hiermit nichts zu tun! Die Olympischen Spiele 1936, 1980 oder 1984 sind, je nach politischen Sichtweise umstritten. Sind aber Geschichte! Ein Teil unseres historischen Erbes.
Es ist stets sinnvoll an Geschichte zu erinnern.
Sie können sich hier, wie jeder andere User beteiligen, oder auch nicht!
VIRIBUS UNITIS
Re: Geschichte des Sports
Jörg Valtin » Do 3. Mär 2011, 16:12 hat geschrieben:
Hier geht es um Geschichte - Sportgeschichte! Geschichte im allgemeinen Sinn bezeichnet alles, was geschehen ist. Im engeren Sinne ist Geschichte die Entwicklung der Menschheit, weshalb auch von Menschheitsgeschichte gesprochen wird (im Unterschied etwa zur Naturgeschichte).
Hier sollen in loser Folge Ereignisse aus der Geschichte des Sports ihren Platz finden.
Das es Ereignisse gibt, "über deren Bedeutung man streiten kann" - wie Sie sagen, liegt im Sinne der Geschichte.
Das hat hiermit nichts zu tun! Die Olympischen Spiele 1936, 1980 oder 1984 sind, je nach politischen Sichtweise umstritten. Sind aber Geschichte! Ein Teil unseres historischen Erbes.
Es ist stets sinnvoll an Geschichte zu erinnern.
Sie können sich hier, wie jeder andere User beteiligen, oder auch nicht!
Okay, okay, okay !
War ja nur ne zaghafte Anfrage eines hiesigen Anfängers, der sogleich (dazu) gelernt hat, dass man / frau sich hier offenbar siezt.
Dank für die Info !
johnpaul
"Nichts ist schwieriger im Leben,und nichts erfordert mehr Charakter,
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stehen und laut zu sagen: 'NEIN !' "
(Kurt Tucholsky)
als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stehen und laut zu sagen: 'NEIN !' "
(Kurt Tucholsky)
-
Jörg Valtin
- Beiträge: 953
- Registriert: Donnerstag 17. Dezember 2009, 19:33
- user title: Soli Deo Gloria!
- Wohnort: Frankfurt am Main
Re: Geschichte des Sports
Am 27. April 1908 wurden in London die IV. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit ohne großes Zeremoniell eröffnet. Bis zum Hauptteil der Spiele im Juli finden allerdings nur Wettkämpfe in den vier Sportarten Rackets, Hallentennis, Jeu de Paume und Polo statt.
Im Gegensatz zu den Spielen in Paris 1900 und St. Louis 1904, als die sportlichen Wettkämpfe wegen der chaotischen Organisation zu einem unbedeutenden Anhängsel der jeweiligen Weltausstellung gerieten, fanden die Spiele in London eine weitaus größere Beachtung. Dazu trug vor allem die Tatsache bei, dass mehr als zwei Drittel aller Wettkämpfe auf zwei Wochen im Juli und auf eine einzige Wettkampfstätte konzentriert waren.
23 Länder entsendeten 2.041 Sportler, davon 43 Frauen. Es fanden 110 Wettbewerbe in 22 Sportarten statt. König Eduard VII. (* 9. November 1841 † 6. Mai 1910) eröffnete am 27. April 1908 die Spiele von London. Die Abschlußfeier fand am 31. Oktober 1908 statt.
Quelle: Karl Lennartz: Olympische Spiele 1908 in London. Agon-Sportverlag, Kassel 1998.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
Im Gegensatz zu den Spielen in Paris 1900 und St. Louis 1904, als die sportlichen Wettkämpfe wegen der chaotischen Organisation zu einem unbedeutenden Anhängsel der jeweiligen Weltausstellung gerieten, fanden die Spiele in London eine weitaus größere Beachtung. Dazu trug vor allem die Tatsache bei, dass mehr als zwei Drittel aller Wettkämpfe auf zwei Wochen im Juli und auf eine einzige Wettkampfstätte konzentriert waren.
23 Länder entsendeten 2.041 Sportler, davon 43 Frauen. Es fanden 110 Wettbewerbe in 22 Sportarten statt. König Eduard VII. (* 9. November 1841 † 6. Mai 1910) eröffnete am 27. April 1908 die Spiele von London. Die Abschlußfeier fand am 31. Oktober 1908 statt.
Quelle: Karl Lennartz: Olympische Spiele 1908 in London. Agon-Sportverlag, Kassel 1998.
Viele Grüße aus Frankfurt am Main
VIRIBUS UNITIS