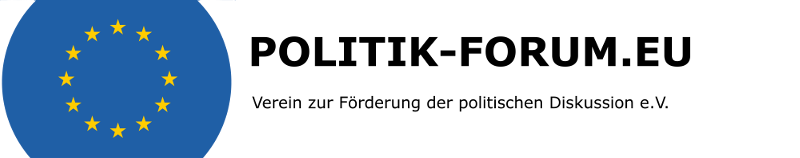Mehr als 200 rumänische Zuwanderer leben an der Hanauer Daimlerstraße. Viele der Roma kamen ihrer Kinder wegen und wollen unbedingt zum „Deutschmodus“ finden. Andere dagegen sind nur schwer zu integrieren.
Obwohl die Familie von Liana und Marina an der Hanauer Straße mit dem schlechtesten Ruf wohnt – der Daimlerstraße am Hauptbahnhof –, haben die beiden Mädchen recht gute Aussichten, in Deutschland ihren Weg zu machen. Sie sind jung genug, um sich einzugliedern und in Schule und Kindergarten mitzukommen. Das nennt ihre Mutter, die 46 Jahre alte Gabriela Popescu (Name geändert), auch als Grund dafür, warum ihr Mann und sie mit neun der zwölf Kinder vor zwei Jahren nach Hanau gekommen sind. Hier sei alles gut, sagt sie, vor allem kümmere man sich um die Kinder.
Ohne Hilfe geht nix:
Mit „man“ ist beispielsweise Beate Hoyer gemeint, eine von sechs Betreuerinnen des Jugendamts, die sich für die Menschen an der Daimlerstraße engagieren. Für Popescu ist sie die „Donna Primaria“, die Dame vom Rathaus, die sich lange um das Vertrauen der Bewohner bemühen musste, jetzt aber bei vielen Familien ein gerngesehener Gast und willkommene Helferin ist. Streetworkerin Lucia Bleibel vom Internationalen Bund (IB) – er betreibt mit der Stadt ein Kooperationsprojekt zur Integration der überwiegend aus Rumänien stammenden Roma – wird „Donna Lucia“ genannt. Seit anderthalb Jahren leistet auch sie Vertrauensarbeit in den acht Häusern. Sie war in fast jeder der rund 70 privat vermieteten Wohnungen, kennt die meisten Bewohner, und diese kennen sie.
"Negative Erscheinungen":
Rund 220 Roma sind nach städtischen Angaben an der Daimlerstraße gemeldet. Dazu kommt eine unbekannte Zahl an nicht gemeldeten Bewohnern, die bei Verwandten und Bekannten unterkommen und bald weiterziehen. Über sie gibt es wenige Erkenntnisse, doch dürfte ihr Anteil an den negativen Erscheinungen der Zuwanderung nicht unerheblich sein.
Integrationsbemühungen:
Die Bemühungen sollen dazu beitragen, dass Kinder wie Liana und Marina eine Chance bekommen. Für ihren ältesten Bruder, den 19Jahre alten Daniel, sieht die Zukunft dagegen eher düster aus. Obwohl die Familie schon zwei Jahre in Deutschland ist, kann er sich kaum verständigen. An drei Vormittagen in der Woche nimmt er an einem Deutsch- und Alphabetisierungskurs des IB teil, auch sein Vater versucht in einem Integrationskurs Sprache und Gebräuche zu lernen. Daniel hat viel aufzuholen, er hat nur kurz Schulen besucht. Mehrere Jahre verbrachte die Familie in Spanien, wo der Vater und die älteren Kinder sich als Landarbeiter verdingten – für 2,50 Euro am Tag, wie die Mutter sagt. Kurzzeitig war die Familie dann wieder in Rumänien, wo alle in einem Zimmer lebten, kochten und schliefen.
"Schwierigkeiten" und Familieneinkommen:
Wie es sie nach Hanau verschlug, darüber spricht Gabriela Popescu nicht. Aber freimütig berichtet sie von den Schwierigkeiten, die zwei der schulpflichtigen Söhne anfangs machten. Von kleineren Diebstählen ist die Rede und vom Schulschwänzen. Doch das sei vorbei, versichert die Mutter, die ihre Besucher in einer penibel aufgeräumten, sauberen Wohnung begrüßt. Auch sie wolle Deutsch in einem IB-Kursus lernen. Die ganze Familie, die von Sozialleistungen lebt, solle in den „Deutschmodus“ kommen. Und ihr größter Wunsch sei es, dass ihr Mann und ihr ältester Sohn eine Arbeit fänden.
Ein Erfolg: nur Teilzeitstütze:
Auf diesem Weg ist Familie Ionescu im Nachbarhaus schon ein gutes Stück weiter. Vater Ioan versorgt sie mit seinem Schrotthandel weitgehend selbst, nur ein Teil des Familieneinkommens steuert das Sozialamt bei. Auch in Rumänien habe der Vater immer Arbeit gehabt, berichtet Mutter Ana stolz.
Ausbildung von Fachkräften:
Nach Deutschland seien sie vor allem wegen der beiden behinderten Kinder gekommen. Eine 24Jahre alte Tochter arbeitet in einer Behindertenwerkstatt in Langenselbold, ihr jüngerer Bruder besucht eine Schule für Hörbehinderte in Frankfurt. An solche Hilfe sei in Rumänien nicht zu denken gewesen, sagt Ana Ionescu, die kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um ihre Nachbarn geht. Sie seien neidisch auf die Familie, vor allem auf den knapp siebzehnjährigen Sohn Eugen. Er hat in den drei Jahren in Hanau gut Deutsch gelernt und besucht die Ludwig-Geissler-Schule. Nach seinem Hauptschulabschluss möchte er eine Lehre als Automechaniker oder als Einzelhandelskaufmann machen. Seine Chancen für einen Ausbildungsplatz zumindest im Lebensmittelhandel stehen nach einem absolvierten und einem bevorstehenden Praktikum gut.
Interne Hierarchien:
Eugen nickt, wenn seine Mutter über Mitbewohner in den Häusern schimpft. Viele seien aggressiv, ließen die Treppenhäuser verwahrlosen und hätten kein Benehmen, wettert Ionescu in ihrem adretten Wohnzimmer. Auch Eugen gehen die verwahrlosten Flure und dunklen Treppenhäuser, der Müll und die achtlos weggeworfenen Möbel rund um die Wohnanlage auf die Nerven.
Aber immerhin:
Allerdings hat sich nach ihren Beobachtungen schon einiges zum Besseren entwickelt in der Wohnanlage. Der Müll sei weniger geworden, und alle schulpflichtigen Kinder der gemeldeten Familien gingen regelmäßig zur Schule, sagt Lucia Bleibel. Auch die Beschwerden aus der Nachbarschaft über untragbare hygienische Verhältnisse seien deutlich zurückgegangen. Immer öfter sei zudem zu beobachten, wie Bewohner – meist Frauen – auf der Straße mit Schippe und Besen hantierten. Ganz langsam wachse die Zahl derer, die einsähen, dass es Vorteile habe, sich wenigstens ein Stück weit an die hiesigen Regeln zu halten.
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/r ... ticle=true
Kein Zuwanderungsland auf der Welt würde so eine Zuwanderung akzeptieren, warum aber Deutschland? Nun, die Freizügigkeit ist ein Thema, aber es ist eine Frechheit in ein anderes Land zu ziehen um dort dann Sozialleistungen zu kassieren.
Es spricht nichts gegen die Freizügigkeit, aber geht das nur im Zusammenhang mit Stützezahlungen und Betreuung, etc... ??
"Sie verbieten nicht die Hassrede. Sie verbieten die Rede, die sie hassen"