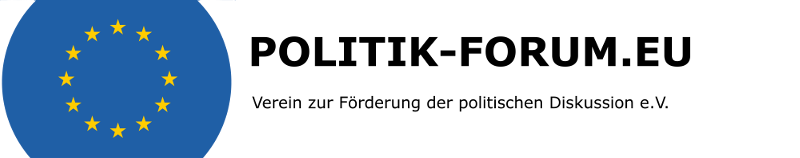Da drauf währe ich nun nicht von alleine gekommenSPIEGEL ONLINE: Was heißt das konkret?
De Hond: Wer heute in eine Koalitionsregierung geht, wird dafür höchstwahrscheinlich von seinen Wählern bestraft. Dies gilt vor allem für die kleineren Parteien, denn die Partei des Regierungschefs kann noch am ehesten ihre Vorstellungen durchsetzen oder Erfolge für sich reklamieren. Schauen Sie doch, wie es SPD und FDP als Juniorpartnern von Merkel ergangen ist. Und je mehr Parteien in der Regierung sind, desto größer wird die Gefahr, dass sie massiv Stimmen verlieren.
SPIEGEL ONLINE: Wieso?
De Hond: Je mehr Parteien sich auf einen Koalitionsvertrag einigen müssen, desto größer sind die Zugeständnisse, die jede einzelne Partei machen muss. Und mit jedem Zugeständnis enttäuscht eine Partei Tausende eigene Wähler. Diese gehen dann zu den Oppositionsparteien oder neuen politischen Bewegungen, die keine Kompromisse machen müssen und die reine Lehre predigen können. Dadurch wächst die Zahl der Parteien. Und nach der nächsten Wahl braucht man noch mehr Parteien für eine Koalition - die dann noch mehr Zugeständnisse machen müssen und sich von ihren Wähler weiter entfremden. Das stärkt die Ränder.
SPIEGEL ONLINE: Ihrer Argumentation zufolge hat Christian Lindner also genau das Richtige getan, als er ausgestiegen ist aus den Jamaika-Sondierungen...
De Hond: Für Deutschland und sein politisches System war das schlecht. Neuwahlen werden die Lage wohl kaum verbessern. Aber für die FDP war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich kann mir vorstellen, dass viele Parteimitglieder gedacht haben: Wenn wir da mitregieren, stürzen wir bei der nächsten Wahl wieder unter fünf Prozent.
SPIEGEL ONLINE: Glauben Sie nicht, dass es die Wähler der FDP übelnehmen, wenn sie sich der Verantwortung entzieht?
De Hond: Kurzfristig vielleicht, auf Dauer kaum. In den Niederlanden zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass man in der Opposition meistens zulegt. Ein Beispiel: Die Sozialdemokraten, die Juniorpartner in Ruttes alter Regierung waren und sich nach der Wahl im März kategorisch geweigert haben, bei Rutte III mitzumachen, werden wieder beliebter. Die vier neuen Koalitionspartner hingegen verlieren.
SPIEGEL ONLINE: Koalitionen und Kompromisse gab es immer schon. Was hat sich so verändert?
De Hond: Früher gab es große, klar voneinander abgegrenzte gesellschaftliche Gruppen wie Arbeiter oder Bauern, Unternehmer oder Katholiken. Innerhalb dieser Blöcke waren die Meinungen der einzelnen Wählern zu grundlegenden politischen Fragestellungen oft mehr oder weniger ähnlich. Die Volksparteien konnten ihr Programme auf sie ausrichten und politische Pakete schnüren. Heute haben sich die traditionellen Parteienbindungen weitgehend aufgelöst, und das Zusammenleben ist differenzierter.
SPIEGEL ONLINE: Was folgt daraus?
De Hond: Fast jeder Bürger hat seine individuellen Vorstellungen zu großen Themen. Ein Wähler etwa, der für strikten Umweltschutz ist, kann in der Flüchtlingsfrage oder zur Euro-Rettung völlig anderer Meinung sein als ein anderer Umweltschützer. Er wählt eine bestimmte Partei nur oder vor allem wegen eines bestimmten Standpunkts. Und wenn "seine" Partei dann bei genau diesem Thema einen Kompromiss eingeht, springt er wieder ab.
SPIEGEL ONLINE: Ist der unreife Wähler also schuld an allem?
De Hond: Nein. Das System stammt in seinen Strukturen aus dem 19. Jahrhundert. Alle vier oder fünf Jahre sollen die Wähler ein Kreuz machen, alles andere übernimmt dann die Partei. Das passt nicht mehr zu unserer heutigen fragmentierten Gesellschaft. Es ist Zeit für eine Reform.
SPIEGEL ONLINE: Wie könnte eine Reform denn aussehen? Soll es keine Koalitionen mehr geben?
De Hond: Doch, aber die Koalitionspartner sollten nur einige grundlegende Vorhaben vereinbaren. Koalitionsverträge, die alles mögliche bis ins kleinste Detail regeln, sind völlig inflexibel. Sobald eine Krise kommt, wovon man ausgehen muss, ist alles ganz anders - und dann gibt es erst recht Streit.
SPIEGEL ONLINE: Aber wenn man sich nicht am Anfang einigt, wie soll es dann während der Legislaturperiode klappen? Wie sollen Minister dann ihre politischen Projekte durchsetzen - etwa ohne die Unterstützung ihrer Koalitionspartner?
De Hond: Die Minister müssen sich für diese Vorhaben Mehrheiten im Parlament suchen. Das befördert dann auch die gesellschaftliche Debatte.
SPIEGEL ONLINE: Aber was ist, wenn die Opposition einfach Nein sagt - um den Minister zu blamieren und die Regierung als handlungsunfähig darzustellen?
De Hond: Die Oppositionsparteien können nicht kategorisch Nein zu allem sagen. Auch sie müssen die Interessen ihrer Wähler vertreten, sonst werden sie abgewählt. Die Minister können die Anliegen ihrer Partei der Öffentlichkeit vortragen. Und wenn sie dafür eine Mehrheit kriegen, können sie diese Vorhaben umsetzen: frei von Koalitionszwängen. Wenn es nicht reicht, ist deswegen niemand blamiert.
Ich bin der Ansicht, man könnte das noch einfacher machen: Schaffen wir doch die Parlamente ab und regeln alles über Volksabstimmungen und Betitionen. Jeder kann Online mitmachen und wenn es genügend Leute gibt, die eine Petition unterstützen, wird das zum Gesetz. Wir hätten dann auch keine überflüssigen Diäten und Renten für ehemalige Mandatsträger.