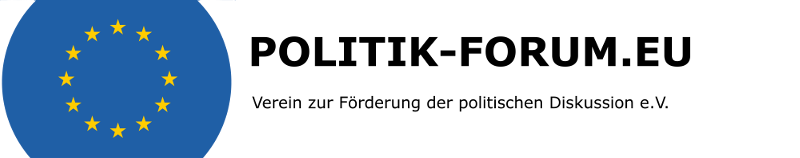Extra für dich

:
Keynesianismus
nach dem britischen Nationalökonomen John Maynard Keynes (*1883, †1946) in seinem 1936 veröffentlichten Hauptwerk »Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« benannte makroökonomische Theorie und wirtschaftspolitisches Konzept.
In seiner berühmten Theorie zeigte Keynes insbesondere, dass Angebot und Nachfrage auf den Märkten nicht automatisch zu einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht führen, bei dem auch Vollbeschäftigung herrscht. Danach gibt es also auch in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen häufiger Arbeitslosigkeit, ohne dass die Marktkräfte allein einen Aufschwung bewirken können und z.B. über Lohnsenkungen die Arbeitslosigkeit beendet und Vollbeschäftigung erreicht wird. Nach Keynes liegt der Grund für konjunkturelle Einbrüche begleitet von Arbeitslosigkeit in einer zu geringen Nachfrage nach Gütern, vor allem nach Investitionsgütern. Die Investitionsgüternachfrage wiederum ist abhängig von den zukünftigen Gewinnerwartungen der Unternehmen. Die Unternehmen werden dabei nur so viele Arbeitnehmer beschäftigen, wie sie für die Herstellung ihrer Gütermengen benötigen. Sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Gütern, wird weniger produziert und die Unternehmen entlassen einen Teil der Arbeitnehmer. Arbeitslosigkeit wiederum führt zu verringerten Einkommen, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Konsumgütern weiter sinken lässt und noch höhere Arbeitslosigkeit bewirkt.
Um nun wieder Vollbeschäftigung zu erreichen, muss die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage steigen. Insbesondere die Investitionsgüternachfrage muss zunehmen, denn steigende Investitionen schaffen Arbeitsplätze und damit Einkommen, was wiederum die Nachfrage nach Konsumgütern ankurbelt und weitere Investitionen zur Folge hat. Die Investitionsneigung der Unternehmen hängt jedoch von der Höhe der Zinsen ab. Ist der Zins hoch, wird die Investitionsneigung der Unternehmen gering sein, was keine positiven Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage hat. Ist der Zins für Kredite dagegen niedrig, haben die Unternehmen eine höhere Gewinnerwartung und damit einen größeren Anreiz zu investieren. Aber selbst bei sinkenden Zinsen kann die Investitionsneigung der Unternehmen gering sein, weil sie z.B. hoffen, dass die Zinsen noch weiter fallen.
In dieser Situation ist nach Ansicht von Keynes der Staat gefragt, der dafür sorgen muss, dass die fehlende private Nachfrage durch staatliche Nachfrage ersetzt und so die Wirtschaft aus der Krise (Unterbeschäftigungsgleichgewicht) herausgeführt wird. Indem der Staat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage direkt durch Erhöhung seiner Ausgaben z.B. für öffentliche Aufträge wie den Bau von Straßen, Schienenwegen oder öffentlichen Gebäuden, oder indirekt, z.B. durch Steuervergünstigungen für Investitionen, steuert, trägt er zur Belebung der Wirtschaft bei. Das schafft neue Arbeitsplätze und Einkommen bei den privaten Haushalten, die wiederum mehr Konsumgüter nachfragen, was wieder Investitionen der Unternehmen bewirkt und weitere Arbeitsplätze schafft.
Die staatliche Steuerung der Konjunktur im Sinne einer Fiskalpolitik erfolgt dabei je nach konjunktureller Lage, d.h., im Abschwung soll der Staat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage beleben, indem er mehr ausgibt, als er einnimmt, und dadurch seine Schulden erhöht; man spricht auch von Defizitfinanzierung. Im Aufschwung müssen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dagegen gebremst und die entstandenen Schulden durch Steuererhöhungen getilgt werden. Eine solche antizyklische Wirtschaftspolitik und Globalsteuerung der Wirtschaft im Sinne von Keynes wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren auch in der Bundesrepublik Deutschland betrieben und hat im Stabilitätsgesetz ihren Niederschlag gefunden.
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/l ... esianismus
Eine antizyklische Nachfragepolitik halte ich für sinnvoll, das ist nicht das Problem. Unser politisches System in Verbindung mit teilweise falsch angewandten keynesianischen Forderungen hat in der Vergangenheit zu einer erhöhten Staatsverschuldung geführt. Es wurden einige Vorkehrungen getroffen (Stichwort: Schuldenbremse), um negativen Folgen unserer rein repräsentativen Demokratie bzgl. der Verschuldung zu mindern. Das reicht meiner Meinung nach aber nicht aus, um langfristig den Anstieg der Staatsverschuldung gänzlich zu verhindern. Die Ergänzung der repräsentativen Demokratie um brauchbare, direktdemokratische Elemente und eine stärkere Föderalisierung (Kommunen, Länder müssen bei Überschuldung auch pleite gehen können und sich mit ihren Gläubigern einigen ohne, dass andere Kommunen, Länder, der Bund hinzugezogen wird). Es muss den Menschen (vor Ort) klar sein, dass Sie es sind die, die Ausgaben des Gemeinwesen bezahlen müssen. Es gibt keinen Superhelden names Staat, der die Welt kostenlos in der Wirtschaftskrise errettet. Wir sind die, die das Geld ausgeben und auch wieder zurückzahlen müssen. Durch wirksame direktdemokratische Elemente sind Politiker viel mehr dazu gebracht, tatsächlich auf das Bürgerwohl zu achten, weil das Volk eben Entscheidungen der Politiker ändern kann. (Die Geschichte der Bundesrepublik ist eine Geschichte der Politik im erster Linie Interesse der politischen Klasse, das zieht sich wie ein roter Faden durch fast alle Jahrzehnte - und erst in zweiter Linie stehen die Interessen der Bürger) Die Einleitung von Konjunkturmaßnahmen kann kaum durch eine Volksabstimmung zu Stande kommen, aber die Aufhebung von solchen kann schon durch die Initiative zu einer solchen (weil die Bürger wissen, dass sie es sind, die das bezahlen müssen) anregt werden und spätestens durch ein solche beschlossen werden.